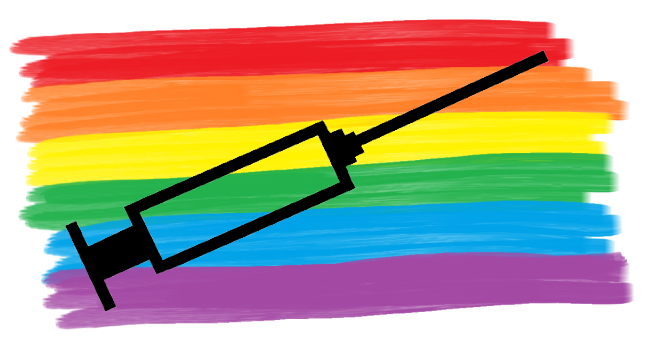Gender Detransition. Ein Einstieg in ein wichtiges Thema
5. November 2022Weiterlesen „… als die Entscheidung, die jemand trifft, um die soziale und medizinische Transition zu einem anderen Geschlecht zu beenden. Diejenigen, die eine soziale Detransition durchliefen (Outing, Namensänderung, etc.), aber ihren Prozess abgebrochen haben, bevor sie sich trans-bezogenen Behandlungen oder Operationen unterzogen, werden als „Desister“ bezeichnet.“ (PostTrans) Aber Vorsicht beim Verständnis: Es mag so scheinen, dass Menschen, die sich für eine Detransition entscheiden, einfach wieder das Geschlecht annehmen, dessen Merkmale sie bei ihrer Geburt aufwiesen. Jedoch haben viele auch weiterhin das Problem, sich nicht genau einem Geschlecht zuordnen zu können. Erschwert wird dies oftmals zusätzlich, wenn geschlechtsangeleichende Operationen durchgeführt wurden und/oder aufgrund von Hormoneinnahme Änderungen in Stimme und Erscheinungsbild aufgetreten sind. Detransition ist also nur eine bedingte Rück-Transition. Für einige ist es ein weiterer Schritt der Selbstfindung, für andere bedeutet es, zwischen allen Stühlen zu stehen. Gerade für letztere ist dabei die Emotionalität, mit der dieses Thema von allen Seiten behandelt wird, eine besondere Belastung. „So aufgeregt die Debatte in den Medien geführt wird, so dünn ist die Datenlage – und das gilt gleichermaßen für Trans-Personen wie für diejenigen, die detransitionieren.“ (Deutschlandfunk-Kultur) Nicht nur Transmenschen, sondern alle, die nicht in das binäre Mann-Frau-Schema passen, können von Diskriminierung bis hin zu Gewalt betroffen sein. Der Deutschlandfunk nimmt auf dieses Dilemma Bezug, wenn er darauf verweist, dass Geschichten über Detransition immer auch das Potenzial haben, missbräuchlich verwendet zu werden. Wenn also einige Detransitionierer*innen aufgrund ihrer Erfahrungen mehr Vorsicht und bessere Begleitung fordern, steht auf der anderen Seite die trans Community, die ihre Rechte in Gefahr sieht. Dabei haben beide Gruppen gleiche Interessen - die Suche und gesellschaftliche Anerkennung des eigenen Geschlechts. Gerade Jugendliche benötigen meist etwas mehr Beratung, da sie sich unabhängig davon, ob sie Transmenschen sind oder nicht, immer in einer Transitionsphase mit entsprechender Identitäts-Unsicherheit befinden. Aber auch Erwachsene – sowohl während einer Transition als auch bei einer Detransition - sind sich nicht unbedingt über mögliche Nebenwirkungen im Klaren. Wie der Deutschlandfunk in seinem Podcast anmerkt, können gerade Hormonbehandlungen nicht einfach abgebrochen werden, sondern benötigen medizinische Begleitung und entsprechende Beratung, die jedoch meist fehlt. Persönliche Schicksale treffen also auf die politische Verwertungslogik von öffentlichen Debatten. Das Problem, das dabei entsteht, liegt nicht in der Unmöglichkeit aufeinander zuzugehen, sondern in der emotionalen Aufladung, mit der das Thema belastet ist und die zu einer verstärkten Verunsicherung der Beteiligten führt. Doch: „Detransition sollte als Part der geschlechtlichen Vielfalt und die detransitionierenden Menschen als Teil der trans*Community verstanden werden, bzw. ihre Geschichten als Teil der Trans Studies“ (Vanessa Slothouber auf: dgti).