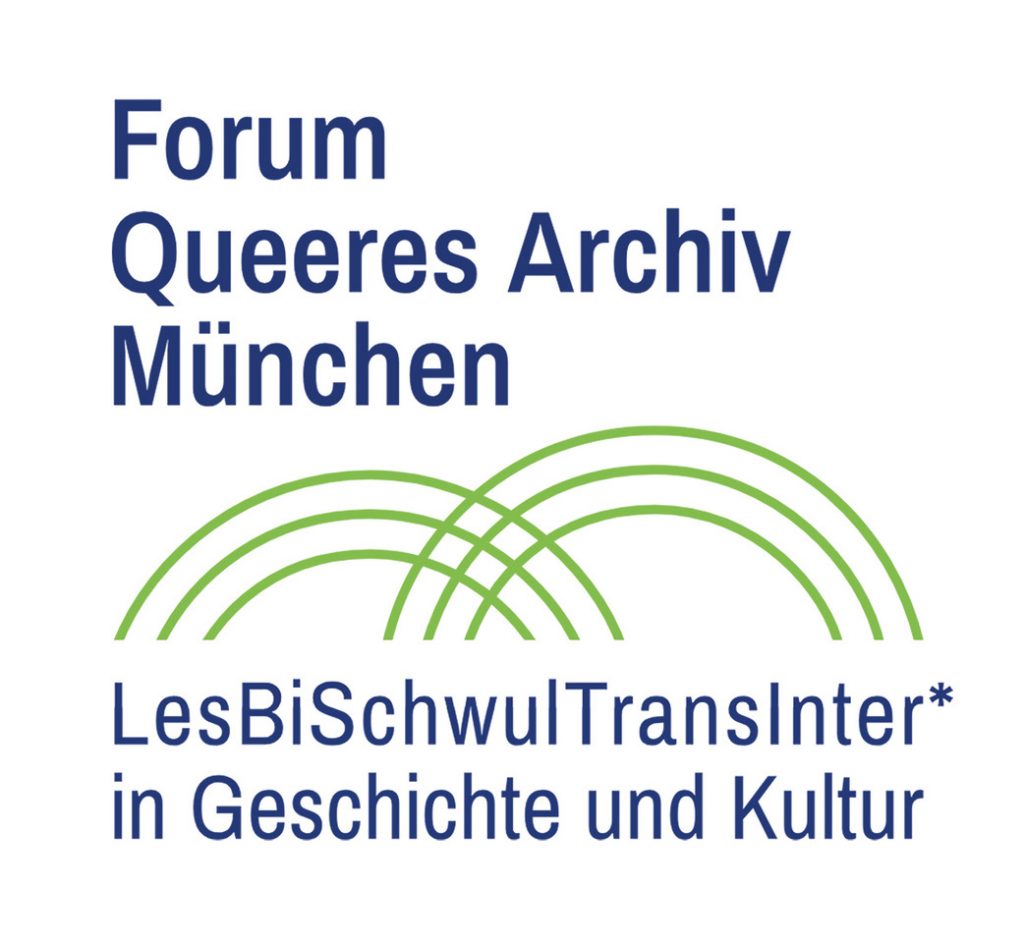Zunahme von Gewalttaten im Zusammenhang mit queerem Dating – Was ist die Realität? Wie geht es Betroffenen? Und wie kann ich mich schützen?
24. Februar 2026Weiterlesen Wie das Magazin Schwulissimo bereits vor über einem Jahr berichtete, nutzen Täter*innen Dating-Apps systematisch, um queere Menschen in Hinterhalte zu locken und sie dann zu überfallen, zu verletzen und auszurauben. Der vermeintlich oder ehemals sichere community-nahe Raum verliert seinen geschützten Charakter. Die Taten folgen häufig einem ähnlichen Muster: Über Dating-Apps wird Kontakt aufgebaut, Sympathie erzeugt und ein Treffen vereinbart. Vor Ort kommt es dann zu Überfällen. Gerade schwule oder bisexuelle Männer* bewegen sich häufiger in anonymen öffentlichen Räumen, etwa in Parks oder Seitenstraßen, auch weil sie nicht geoutet sind oder Diskretion suchen. Diese Umstände werden von Tätergruppen gezielt ausgenutzt. Angriffe finden jedoch auch in den eigenen Wohnräumen der Opfer statt. Was zurückbleibt, sind Erfahrungen, die das Leben der Betroffenen tiefgreifend prägen. Viele entwickeln Ängste und Panik, ziehen sich zurück und beenden ihr offenes Dating- und Sexleben. Die gerade erlangte Freiheit, sich offen sexuell ausleben zu können, wird durch Gewalt und Angst erneut eingeschränkt. Hinzu kommt mangelndes Verständnis für die Opfer – innerhalb wie außerhalb der Community. Nicht selten kommt es zu Täter-Opfer-Umkehr, indem Betroffenen „Leichtsinn“ unterstellt wird. Plattformen wie Grindr, die auf geosozialer Interaktion basieren, können diese Dynamiken begünstigen. Profile werden auf Grundlage des geografischen Standorts angezeigt, spontane Begegnungen werden gefördert. Frühere Sicherheitslücken, bei denen sogar Personen ohne eigenes Profil auf Standortdaten zugreifen konnten, zeigen, wie solche Funktionen gezielte Angriffe erleichtern können. Konkrete Zahlen zu queerfeindlichen Taten sind schwer zu benennen, da viele Übergriffe nicht angezeigt werden. Gründe sind fehlendes Outing, Angst vor respektlosem Verhalten durch Behörden oder Scham, weil das Treffen als sexuelles Date geplant war. Zudem erschwert die häufige Anonymität der Profile die Ermittlungen. Gleichzeitig spiegeln sich steigende queerfeindliche Gewaltformen in den Zahlen politisch motivierter Kriminalität wider. Für 2024 wurden im Unterthemenfeld „sexuelle Orientierung“ 1.765 Straftaten (+18 %) registriert, im Bereich „geschlechtsbezogene Diversität“ 1.152 Fälle (+35 %). Eine Vielzahl dokumentierter Fälle aus verschiedenen Städten zeigt, dass sich Gewalttaten im Zusammenhang mit Dating-Apps häufen (der LSVD+ dokumentiert die Taten hier). Nur bei wenigen dieser Taten konnte innerhalb eines Strafprozesses Homophobie oder Queerfeindlichkeit als Tatmotiv festgestellt werden, was auch mit der schwierigen Identifizierung der Täter zusammenhängt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele dieser Übergriffe von queerfeindlichen Einstellungen begleitet werden. Gewalt im Kontext queeren Datings ist kein Randphänomen, sondern Ausdruck wachsender gesellschaftlicher und struktureller Queerfeindlichkeit. Sichere Räume – auch digitale – zu verteidigen, bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zugleich braucht es einen Ausbau der Prävention, konsequente Strafverfolgung und solidarische Unterstützung für Betroffene. Wo und wie können Betroffene Hilfe suchen? Bei akuter Gefahr gilt: 112 oder 110. Präventionsmöglichkeiten Vor dem Date können Video-Calls oder Social-Media-Abgleiche zur Verifizierung beitragen. Freund:innen sollten über Ort und Zeit informiert werden.
Nach einem Vorfall sollten medizinische Versorgung gesichert, Beweise dokumentiert und – auch anonym möglich! – Anzeige erstattet werden. Auch Beratungsstellen bieten Unterstützung, zum Beispiel:
Beim Treffen empfiehlt sich ein öffentlicher Ort für das erste Date, eine eigenständige An- und Abreise sowie Aufmerksamkeit im Umgang mit Getränken.
Digital sollten Standortfreigaben eingeschränkt und sensible Daten nicht im Profil hinterlegt werden.