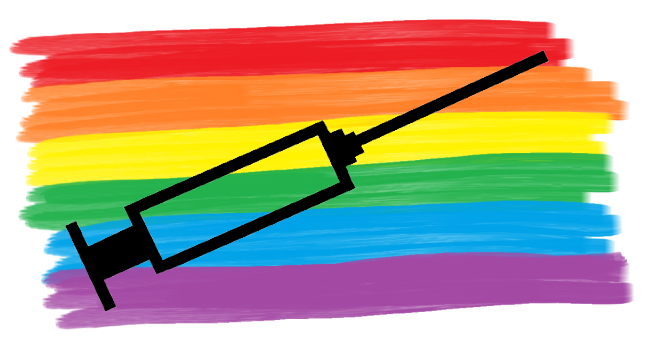Wie das Ärzteblatt am 22. März berichtete, wird die neue Leitlinie im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wie etwa Schweden, Finnland oder Großbritannien für den deutschsprachigen Raum weniger restriktiv ausfallen. Während in den genannten Ländern die Vergabe von Pubertätsblockern nur noch im Rahmen von Studien zulässig ist, dürfen sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter bestimmten Auflagen weiter eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine angemessene kinder- und jugendpsychiatrische beziehungsweise psychotherapeutische Einschätzung. Hinzu kommt eine Beratung durch eine pädiatrisch-endokrinologische Fachperson. Hierbei müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Es muss eine anhaltende Geschlechtsinkongruenz festgestellt werden und gleichzeitig ein geschlechtsdysphorischer Leidensdruck bestehen.
Dass eine Geschlechtsinkongruenz zum Leidensdruck führt, ist nicht unplausibel, aber auch nicht zwangsläufig gegeben. Ein zentraler Punkt bildet dabei das Verhältnis von Risiko und Nutzen. Wie die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, Universitätsmedizin Göttingen, und Autorin der Leitlinie Claudia Wiesemann gegenüber dem Ärzteblatt betont, seien die Nebenwirkungen im Vergleich zur Krisensituation der Geschlechtsdysphorie in der Regel unerheblich. Dem gegenüber stellt die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die auch auf Wiesemann verweist, die Kritik von Florian Zepf, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Jena und früher selbst Mitglied in der Leitlinienkommission: Zepf mahnt an, dass sich auch mit der neuen Leitlinie die medizinische Datenlage nicht verbessert habe. Insbesondere Langzeitfolgen wie Unfruchtbarkeit und Auswirkungen auf den Hirnreifungsprozess müssten bei der Risiko-Nutzen-Analyse berücksichtigt werden.
Bereits im vergangenen Jahr 2023 hatte das Ärzteblatt eine Entscheidung des National Health Service (NHS) in Großbritannien aufgegriffen, wonach Pubertätsblocker nur noch in Ausnahmefällen Minderjährigen verschrieben werden dürfen. Auch hier lautete die Begründung eine zu geringe Forschungslage in puncto Sicherheit und Wirksamkeit. Aber auch bei Nutzerstudien ist die Situation nicht eindeutig. Während eine Studie aus Amsterdam zeigt, dass 98% der Jugendlichen, die Pubertätsblocker und Hormone einnahmen, die Therapie über mindestens vier Jahre fortsetzten, fragen laut einer US-Studie etwa 25,6 % derjenigen, die vor dem 18. Lebensjahr eine Therapie begannen, innerhalb von vier Jahren keine weiteren einschlägigen Rezepte mehr nach. Zudem macht der Artikel des Ärzteblatts vom letzten Jahr mit Bezug auf einen Artikel von Reuters zum Thema Detransition deutlich, dass nur ein Viertel der Betroffenen ihre Detransition den behandelnden Ärzt*innen kommunizieren. Damit könnte die tatsächliche Anzahl derer, die sich umentscheiden, unterschätzt sein. Auch wir hatten bereits das Thema Detransition aufgegriffen und waren zu dem Schluss gekommen, dass vor allem die Tabuisierung von Detransition Gefahren birgt, indem sie Leidenswege verdecken kann.
Mit dem Spannungsfeld dieser z.T. widersprüchlichen Studien ist es umso wichtiger klarzustellen, dass die S2k-Leitlinie kein Garant für absolute Sicherheit ist, sondern laut AWMF auf dem Konsens der beteiligten Fachleute beruht. Daher bleibt weiterhin eine genaue und situationsabhängige Abwägung der individuellen Umstände erforderlich.
Und genau an dieser Stelle kommt die Frage der Selbstbestimmung in den Diskurs. Auch wenn Minderjährige ein Recht auf Selbstbestimmung haben, obliegen Pflege und Sorge laut Art. 6 GG nicht umsonst den Eltern, und die Gesellschaft hat die Pflicht, darüber zu wachen. Selbstbestimmung erhält also insbesondere dann Grenzen, wenn die Selbstfürsorge in Frage steht. Das bedeutet aber auch, dass im gleichen Moment die Verantwortung auf die Entscheidungsträger übertragen wird. Selbst wenn zukünftig die Datenlage verbessert wird, bleibt dieser Umstand erhalten. Umso jünger und größer die Unsicherheit, umso geringer der Einfluss auf eine Behandlungsentscheidung. Damit ist explizit ein Einbezug nicht ausgeschlossen. Eltern und Expert*innen spielen daher eine entscheidende Rolle, sei es durch direkte Entscheidungen für Minderjährige oder durch ihre Autorität in Beratungssituationen. Damit wird es aber umso notwendiger, dass alle Beteiligten, einschließlich der Fachkräfte, ihre Rolle reflektieren und sicherstellen, dass die Bedürfnisse und Rechte der Minderjährigen angemessen berücksichtigt werden. Dies erfordert Selbstdisziplin, um persönliche Überzeugungen nicht über das Wohl der Minderjährigen zu stellen. Diese Prinzipien gelten allerdings ebenso für erwachsene Personen, die Rat und Hilfe bei solchen Entscheidungen suchen.
Schließen