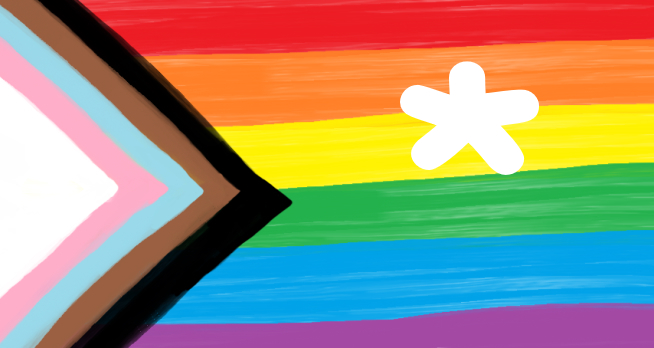LGBTIQ* Personen mit Behinderung
19. März 2024Weiterlesen In unseren vergangenen Artikeln haben wir in diesem Zusammenhang bereits die Themen LGBTIQ* und Asyl und LGBTIQ* im Alter aufgegriffen. Gemein ist beiden Themen, dass besonders diejenigen gefährdet sind, die es nicht schaffen, aus eigener Kraft Anschluss zu finden, Kontakte zu knüpfen oder zu wissen, wohin sie sich wenden können. Im Alltag entsteht hier besonders dort Handlungsbedarf, wo die Hilfeeinrichtungen wenig oder nichts über die jeweils andere Thematik und ihre Schnittstellen mit dem eigenen Schwerpunkt wissen. Eine weitere Gruppe, die in dieses Spektrum fällt, sind LGBTIQ* Personen mit Behinderungen. Aufgrund der Komplexität ihrer Identität erfahren auch sie multiple Formen der Diskriminierung und zusätzliche Hindernisse beim Zugang zu spezifischer Unterstützung und Ressourcen. Auf diese Gruppe macht die Fachstelle Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in ihrem Newsletter vom Dezember 2023 aufmerksam. Unter anderem geht es dabei auch um Sexualität. Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, ihr Recht auf sexuelle Entwicklung wahrzunehmen, ist als solches bereits ein Thema, das von Fachkräften eine adäquate Haltung und Bildung verlangt. Informationen dazu bietet unter anderem die Lebenshilfe. Dass diese Menschen aber auch LGBTIQ* sein können, findet dabei selten Erwähnung. Die EUTB zielt darauf ab, LGBTIQ* Personen mit Behinderungen dabei zu unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen und eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Die Angebote sind dabei ergänzend zu den bereits existierenden Beratungsangeboten von Leistungsträger*innen und Leistungserbringer*innen. Konkret auf Sexualität bezogene Angebote finden sich hier allerdings nicht. Dennoch ist das Angebot der EUTB ortsunabhängig, sodass Betroffene, Vereine und Einrichtungen sich auch dann an die EUTB wenden können, wenn sie nicht in der Nähe wohnen. Potenzielle Mehrfachdiskriminierung erfordert Aufklärung, das gilt ebenso für LGBTIQ* Personen mit Behinderung. Insbesondere Dachverbände und Träger sollten dabei auf Lücken achten, die im Alltag vielleicht übersehen werden. Das Angebot der EUTB kann dabei eine Ergänzung bieten und einen Einstieg ins Thema ermöglichen. Gerade wenn es aber konkret um das Thema Sexualität geht, werden Verantwortliche sowie Betroffene nicht umhinkommen, sich Beratung von verschiedenen Richtungen zu holen.