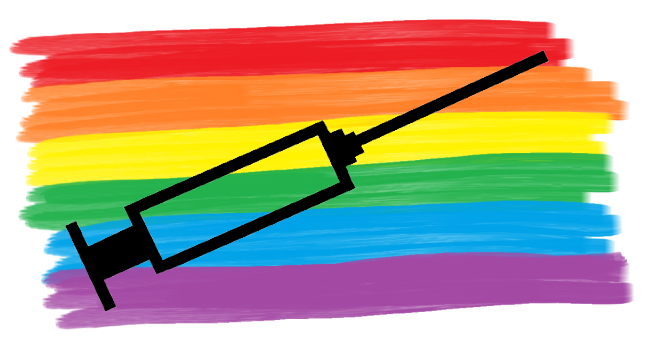Weiterlesen „Fireworks“ wird vom Online-Magazin queer.de als „einer der eindruckvollsten und wichtigsten queeren Film[e] in diesem Jahr“ gelobt. Der Film von Guiseppe Fiorello bezieht sich auf einen wahren Vorfall; den Mord an zwei jungen Männern, der im Nachhinein als „delitto di Giarre“ bezeichnet wurde. 1980 wurden in der Stadt Giarre die Körper der beiden Männer, Hand in Hand, aufgefunden. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Das Ereignis gilt als Startpunkt der Mobilisierung der italienische Homosexuellenbewegung: als eine der heute wichtigsten queeren Organisationen in Italien gründete sich als Reaktion auf das Verbrechen die „Arcigay – Associazione LGBQTIA+ Italiana“, außerdem fand 1981 der erste Gay Pride in Palermo statt (für einen Bericht über den Kriminalfall sowie der queeren Bewegung in Italien siehe einen Artikel des Libertine Magazin). Der Film wird auf der Webseite der Queerfilmnacht folgendermaßen beschrieben: „Sizilien im Sommer 1982. Während ganz Italien vom Gewinn der Fußball-WM träumt, träumen Gianni und Nino von einer Liebe ohne Angst. Die beiden Teenager lernen sich mit einem großen Knall kennen, als sie auf einer Landstraße mit ihren Mopeds zusammendonnern. Um den Unfall wieder gut zu machen, bietet Nino dem anderen Jungen einen Job bei seinem Vater an, der Feuerwerke veranstaltet. Gianni und Nino werden erst Freunde und bald Geliebte. Doch als ihre konservativen Familien von der Beziehung erfahren, sehen sich die beiden brutalen Anfeindungen ausgesetzt. Wild entschlossen wollen Gianni und Nino für ihre Liebe kämpfen – und bringen sich damit in Lebensgefahr.“ Hier die Termine für Schleswig-Holstein und Bremen: Weitere Termine, Infos und Tickets auf der Webseite der Queerfilmnacht. Auch die Filme der Queerfilmnacht im August und September 2024 sind bereits bekannt: im August wird „Patagonia“ von Simone Bozzelli gezeigt, im September „Der Sommer mit Carmen“ von Zacharias Mavroeidis. Außerdem findet vom 5. bis 11. September das Queerfilmfestival 2024 in elf Städten statt.
Jugend
Die Notwendigkeit von Selbstdisziplin beim Diskurs um die Anwendung von Pubertätsblockern
28. März 2024Weiterlesen Wie das Ärzteblatt am 22. März berichtete, wird die neue Leitlinie im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wie etwa Schweden, Finnland oder Großbritannien für den deutschsprachigen Raum weniger restriktiv ausfallen. Während in den genannten Ländern die Vergabe von Pubertätsblockern nur noch im Rahmen von Studien zulässig ist, dürfen sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter bestimmten Auflagen weiter eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine angemessene kinder- und jugendpsychiatrische beziehungsweise psychotherapeutische Einschätzung. Hinzu kommt eine Beratung durch eine pädiatrisch-endokrinologische Fachperson. Hierbei müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Es muss eine anhaltende Geschlechtsinkongruenz festgestellt werden und gleichzeitig ein geschlechtsdysphorischer Leidensdruck bestehen. Dass eine Geschlechtsinkongruenz zum Leidensdruck führt, ist nicht unplausibel, aber auch nicht zwangsläufig gegeben. Ein zentraler Punkt bildet dabei das Verhältnis von Risiko und Nutzen. Wie die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, Universitätsmedizin Göttingen, und Autorin der Leitlinie Claudia Wiesemann gegenüber dem Ärzteblatt betont, seien die Nebenwirkungen im Vergleich zur Krisensituation der Geschlechtsdysphorie in der Regel unerheblich. Dem gegenüber stellt die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die auch auf Wiesemann verweist, die Kritik von Florian Zepf, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Jena und früher selbst Mitglied in der Leitlinienkommission: Zepf mahnt an, dass sich auch mit der neuen Leitlinie die medizinische Datenlage nicht verbessert habe. Insbesondere Langzeitfolgen wie Unfruchtbarkeit und Auswirkungen auf den Hirnreifungsprozess müssten bei der Risiko-Nutzen-Analyse berücksichtigt werden. Bereits im vergangenen Jahr 2023 hatte das Ärzteblatt eine Entscheidung des National Health Service (NHS) in Großbritannien aufgegriffen, wonach Pubertätsblocker nur noch in Ausnahmefällen Minderjährigen verschrieben werden dürfen. Auch hier lautete die Begründung eine zu geringe Forschungslage in puncto Sicherheit und Wirksamkeit. Aber auch bei Nutzerstudien ist die Situation nicht eindeutig. Während eine Studie aus Amsterdam zeigt, dass 98% der Jugendlichen, die Pubertätsblocker und Hormone einnahmen, die Therapie über mindestens vier Jahre fortsetzten, fragen laut einer US-Studie etwa 25,6 % derjenigen, die vor dem 18. Lebensjahr eine Therapie begannen, innerhalb von vier Jahren keine weiteren einschlägigen Rezepte mehr nach. Zudem macht der Artikel des Ärzteblatts vom letzten Jahr mit Bezug auf einen Artikel von Reuters zum Thema Detransition deutlich, dass nur ein Viertel der Betroffenen ihre Detransition den behandelnden Ärzt*innen kommunizieren. Damit könnte die tatsächliche Anzahl derer, die sich umentscheiden, unterschätzt sein. Auch wir hatten bereits das Thema Detransition aufgegriffen und waren zu dem Schluss gekommen, dass vor allem die Tabuisierung von Detransition Gefahren birgt, indem sie Leidenswege verdecken kann. Mit dem Spannungsfeld dieser z.T. widersprüchlichen Studien ist es umso wichtiger klarzustellen, dass die S2k-Leitlinie kein Garant für absolute Sicherheit ist, sondern laut AWMF auf dem Konsens der beteiligten Fachleute beruht. Daher bleibt weiterhin eine genaue und situationsabhängige Abwägung der individuellen Umstände erforderlich. Und genau an dieser Stelle kommt die Frage der Selbstbestimmung in den Diskurs. Auch wenn Minderjährige ein Recht auf Selbstbestimmung haben, obliegen Pflege und Sorge laut Art. 6 GG nicht umsonst den Eltern, und die Gesellschaft hat die Pflicht, darüber zu wachen. Selbstbestimmung erhält also insbesondere dann Grenzen, wenn die Selbstfürsorge in Frage steht. Das bedeutet aber auch, dass im gleichen Moment die Verantwortung auf die Entscheidungsträger übertragen wird. Selbst wenn zukünftig die Datenlage verbessert wird, bleibt dieser Umstand erhalten. Umso jünger und größer die Unsicherheit, umso geringer der Einfluss auf eine Behandlungsentscheidung. Damit ist explizit ein Einbezug nicht ausgeschlossen. Eltern und Expert*innen spielen daher eine entscheidende Rolle, sei es durch direkte Entscheidungen für Minderjährige oder durch ihre Autorität in Beratungssituationen. Damit wird es aber umso notwendiger, dass alle Beteiligten, einschließlich der Fachkräfte, ihre Rolle reflektieren und sicherstellen, dass die Bedürfnisse und Rechte der Minderjährigen angemessen berücksichtigt werden. Dies erfordert Selbstdisziplin, um persönliche Überzeugungen nicht über das Wohl der Minderjährigen zu stellen. Diese Prinzipien gelten allerdings ebenso für erwachsene Personen, die Rat und Hilfe bei solchen Entscheidungen suchen.
Safer Spaces für queere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Lübeck: Gruppentreffen von Lambda
13. Februar 2024Weiterlesen Jeden Mittwoch finden in Lübeck zwei Treffen für junge Queers statt. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ richtet sich an LGBTQIA* zwischen 12 und 16 Jahren und die „Rosa Einhorn Brigade“ an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren. Der Verein möchte Schutzräume für junge queere Personen schaffen, in denen Bildung, Austausch und Empowerment stattfinden kann. Unter Leitung der Sozialarbeiter*innen Julia Ostermann und Rebecca Herzberg haben die Gruppen einen monatlich wiederkehrenden Ablaufplan erarbeitet. Dabei wechseln die Termine wöchentlich zwischen Basteln, Spielen, gemeinsamem Kochen und Backen und Filmnachmittagen/-abende. Zudem wird einmal im Monat ein Thema besprochen, welches sich die Kinder und Jugendliche gewünscht haben, beispielsweise zum aktuellen politischen Geschehen. Im Schnitt nehmen an der Kinder- und Jugendgruppe Dino-Zug sechs Personen und an der Rosa Einhorn Brigade zehn Personen teil. Das Angebot sei aus vielen Gründen notwendig, betont Gruppenleiterin Julia Ostermann. Im Rahmen der Gruppentreffen und im Austausch mit anderen jungen queeren Personen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigene Identität in einem sicheren Rahmen zu erforschen und entfalten. So soll ein Safer Space geschaffen werden, was nach Angaben der Teilnehmenden auch gelingt. Eine*r der Jugendlichen hebt positiv hervor, dass in den Gruppen die Identität und Pronomen der Teilnehmenden stets respektiert werden und keine Diskriminierung stattfinde. „Ich gehe in die Jugendgruppe, weil ich einen Platz gesucht habe, wo ich komplett sein kann, ohne verurteilt zu werden“, so ein*e andere*r Teilnehmer*in. Der Austausch mit Personen, die die eigene Situation nachempfinden können, scheint für die Jugendlichen von hoher Bedeutung. Das Jugendnetzwerk schafft auch einen Ort, an dem soziale Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden können. Somit soll der Isolation von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt werden, was insbesondere bei jungen LGBTQIA* Personen ein Risiko sei. Auch bei Diskriminierung und Mobbing können die Gruppen die Betroffenen auffangen und unterstützen. Außerdem sollen die Gruppen Bildungs- und Aufklärungszwecke erfüllen: „Durch Workshops, Diskussionen und informative Veranstaltungen, wie z. B. unsere Thementage, können die Kinder und Jugendlichen ein tieferes Verständnis für ihre eigene Identität und die queere Community entwickeln“, so Ostermann. Von den Fachkräften bekommen die Teilnehmenden auch psychosoziale Unterstützung. Zudem bietet das Jugendnetzwerk lambda::nord mit der Beratungsstelle NaSowas auch konkrete Unterstützung bei Fragen rund um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität an. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ findet immer mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr statt, die Gruppe für ältere Teilnehmende „Rosa Einhorn Brigade“ mittwochs von 18:30 bis 21:00 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Jugendnetzwerks lambda::nord. Auf Instagram werden regelmäßig News und Termine zu den Treffen sowie anderen Angeboten des Vereins gepostet: @queere_jugendarbeit_hl
Florida: Verbot der Pride-Flagge?
24. Januar 2024Weiterlesen Es ist nicht das erste Mal, dass Florida mit queerfeindlichen Gesetzesentwürfen Schlagzeilen macht. Nach dem sogenannten „Don‘t Say Gay“-Gesetz, das die Aufklärung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Schulen verbietet sowie Gesetze zur Einschränkung der medizinischen Versorgung von trans Jugendlichen könnte nun auch queere Symbolik kriminalisiert werden. Der Gesetzesentwurf zielt zunächst auf öffentliche Institutionen ab. An öffentlichen Gebäuden, Schulen und Universitäten sollen die Flaggen nicht gehisst werden dürfen. Zudem sollen auch Lehrer*innen und Beamt*innen keine Symbole tragen, die „ideologische” Standpunkte repräsentieren würden. Dies betrifft unter anderem Symbole bezüglich sexueller Orientierung und Gender. Neben der Regebogenflagge gehören dazu trans, inter und bisexuelle Pride-Flaggen. Auch Flaggen in Verbindung mit der Black-Lives-Matter Bewegung sollen verboten werden. Als Begründung wird der Bildungsaspekt herangezogen. Schüler*innen und Studierende würden in Floridas Klassenzimmern „radikalisiert“ werden, so der Republikaner David Borrero (zitiert in The Guardian). Dabei verfolgt er ein Narrativ des Kulturkampfes, in dem Republikaner gegen die vermeintliche Infiltrierung von Kindern und Jugendlichen durch linke, marxistische, „woke“ und Gender-Ideologien angehen müssten. Unter demselben Vorwand soll die Finanzierung von Diversitäts- und Inklusionsprogrammen an Universitäten gestrichen werden (NBC News). Der demokratische Senator Shevrin D. Jones reagiert empört auf den Gesetzesentwurf: „Sind wir in Russland? Sind wir in Cuba? Das ist Autoritarismus. Das ist Faschismus.“ (zitiert in PinkNews). Die Regenbogenflagge solle Hoffnung bedeuten, so Jones. Indem die LGBTIQ* Pride-Flag als Zeichen von Radikalisierung interpretiert wird, werden im Bundestaat immer mehr Ressentiments gegenüber queeren Personen geschürt.
Weiterlesen Bereits im Juli 2021 berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd) über diese Art der Selbstzensur des YouTubers Rezo. Herausgenommen hatte dieser Worte wie: „Homosexualität, homosexuell, schwul und Homophobie.“ Wie Rezo in dem Bericht beschreibt, liegt das Problem darin, Themen anzusprechen, ohne sie beim Namen zu nennen, um nicht herabgestuft zu werden. Ob dies die richtige Vorgehensweise ist oder nicht, sei an dieser Stelle dahingestellt. Laut rnd gibt es allerdings zumindest Indizien dafür, dass der YouTube-Algorithmus Videos mit den eben genannten Buzzwords herunterstufe. Doch auch der umgekehrte Sachverhalt lässt sich bei den Algorithmen finden. Vergisst man beispielsweise auf YouTube bei der Suche nach „LGBTIQ“ das „I“ einzugeben, durch einen Tippfehler oder aus Unkenntnis, so werden vom Algorithmus unter dem Schlagwort „LGBTQ“ mit fünf von sieben Ergebnissen eindeutig rechtspopulistische und menschenverachtende Anti-LGBTIQ*-Inhalte gezeigt. Hierbei ist anzumerken, dass der PC, mit dem diese Recherche vollzogen wurde, in keinen spezifischen YouTube-Account eingeloggt war. Bei einer Wiederholung auf einem anderen Gerät und einem anderen Anschluss zeigte sich ein ähnliches Bild. Besonders für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrem direkten Umfeld Bezugspersonen haben, die sich mit LGBTIQ* auseinandersetzen oder selbst dazugehören, entsteht hier eine ideologische Gefahr. Daran zeigt sich abermals die Bedeutung medialer Bildung, die über eine bloße Anwendung von Medien hinausgeht und stattdessen auch Mechanismen und Inhalte reflektiert. Gleichzeitig zeigt es die Verantwortung der großen LGBTIQ*-Verbände und Vereine sowie ihrer Träger, sich stellvertretend für die gesamte Comunity auf eine juristische Auseinandersetzung auch mit großen Konzernen wie YouTube einzustellen, um für ein Regelwerk in der digitalen Welt zu kämpfen, das die Prinzipien von Würde und Demokratie hochhält. Etwas, dass Einzelne nicht leisten können. Ein zugegebenermaßen ambitioniertes und langwieriges Unterfangen, bei dem der teilweise geäußerte Vorwurf des „Canceln“ mutmaßlich ein ständiger Begleiter bleiben wird. Aber ohne diese Auseinandersetzung wird in einer Welt der digitalen Information der Einsatz für ein neues gesellschaftliches Selbstverständnis kaum gelingen.
Erasmus+ Austauschprogramm fördert LGBTIQ*-Projekte
17. November 2023Weiterlesen Mit Erasmus+ sollen nicht nur interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden, die junge Menschen in einer globalisierten Gesellschaft benötigen, sondern es geht auch um die Stärkung ihrer gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Das Programm legt außerdem einen stärkeren Fokus auf Chancengleichheit und Inklusion. Organisationen und informelle Gruppen können sich beispielsweise auf Fördermittel im Rahmen der Aktion “DiscoverEU Inclusion Action” bewerben, die auf Inklusion, Chancengleichheit und Empowerment von Jugendlichen und jungen Erwachsenen abzielt. Dabei werden kurzzeitige Auslandsaufenthalte von einzelnen Personen oder Gruppen finanziert. Wie steht es um die Förderung von Projekten, die sich für queere Personen einsetzen? Nach Angaben des Tagesspiegel wurden in den Jahren 2021 und 2022 fast 150 Projekte mit LGBTIQ*-Fokus mit einer Gesamtsumme von 8,83 Millionen Euro gefördert. Mehr als doppelt so viele Projekte haben sich beworben. Unter den geförderten Projekten ist „Wikipedia for Peace: Queer“, ein von 2020 bis 2023 angesetztes Austauschprogramm, in dem sich 35 junge Menschen aus sechs EU- und Nicht-EU-Ländern in Österreich getroffen haben, um Artikel zu queeren Themen zu verfassen. Dabei lernen die Teilnehmer*innen nicht nur selbst relevante Inhalte im Bereich LGBTIQ* kennen, sondern tragen auch zur erhöhten Sichtbarkeit dieser Themen im Internet bei. Ein weiteres gefördertes Projekt ist „Queer Rural Identities“, das sich an queere junge Erwachsene insbesondere aus ländlichen Regionen richtet. Hier wurden verschiedene Fragen rund um LGBTIQ* diskutiert. Das Projekt zielt darauf ab, LGBTIQ*-Netzwerke und Aktivismus in ländlichen Gebieten zu fördern und queere Menschen in multikulturellen Umgebungen wie Erasmus+ einzubeziehen. Diese Beispiele zeigen, dass die Förderung von queerpolitischen Projekten einen Beitrag zur Sichtbarkeit und Unterstützung von LGBTIQ*-Personen leisten kann. So wäre eine weitere und umfassendere Unterstützung von Projekten für junge queere Menschen im Rahmen des Erasmus+-Programms wünschenswert.
Alice Weidel im Sommerinterview: AfD gegen Selbstbestimmungsgesetz und Queerpolitik
14. September 2023Weiterlesen In Angriff nimmt Weidel insbesondere das im August beschlossene Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Mit diesem sollen trans und nicht-binäre Personen leichter ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern können. Während dies einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstbestimmung darstelle, weist der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) darauf hin, dass der aktuelle Gesetzesentwurf immer noch einige rechtliche Hürden beinhaltet oder zu Diskriminierung führen könnte. Die Vorsitzende der AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wurde, interpretiert das Gesetz jedoch so, dass Personen sich nun willkürlich ihr Geschlecht aussuchen können. Die Realität der Betroffenen blendet sie dabei komplett aus. Der LSVD erklärt, dass die Verweigerung einer rechtlichen Anerkennung des gelebten Geschlechts diskriminierende und andere negative Auswirkungen für trans- und nicht-binäre Menschen haben kann. Von dieser Personengruppe versucht sich Weidel jedoch zu distanziere. Denn sie betont, dass sie nicht queer sei, sondern „mit einer Frau verheiratet“, die sie „seit 20 Jahren kenne“. Auch wenn die Nicht-Identifizierung mit dem Begriff queer Weidels persönliche Entscheidung bleibt, impliziert sie mit ihren Aussagen zwei Lager zwischen homosexuellen und trans Personen. Weiter fragt sie, wie man die Kinder in den Schulen und Kitas vor einer „Trans-Pop-Kultur“ schützen könne. Stattdessen sollte eher gefragt werden, wie der Diskriminierung von trans Kindern und Jugendlichen in Schulen besser entgegnet werden kann (Tipps für trans Schüler*innen hat z.B. das Regenbogenportal zusammengestellt). Weidel selbst fühle sich als lesbische Frau mit zwei Kindern nicht diskriminiert. Dabei lässt sie das queerfeindliche Programm ihrer eigenen Partei außer Acht, das sich explizit gegen Regenbogenfamilien stellt. Eine viel größere Bedrohung versteht sie in der Genderpolitik der Ampel-Regierung. Dabei reiht sich die rechtspopulistische Partei in eine globale Bewegung von teilweise rechtsextremen, antifeministischen und fundamentalistischen Gruppierungen ein, die gegen eine vermeintliche „Gender-Ideologie“ ankämpfen will.
„Auf dem Weg zu einer diversen Kinder- und Jugendhilfe“ – Digitaler Fachtag der Kinderschutzzentren
28. August 2023Weiterlesen Ziel des Fachtags ist es, die Frage zu thematisieren, „[w]ie es Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe gelingen kann, Freiräume für die Persönlichkeitsentwicklung queerer Kinder und Jugendlicher zu schaffen und zu verteidigen, sie in ihrer Identität zu stärken und ihren spezifischen Bedarfen gerecht zu werden […]“. Dabei sollen neben Impulsen und einem Diskurs auch konkrete Beispiele vorgestellt werden. Für die Veranstalter*innen ist Erkennen und Verstehen der spezifischen Bedarfe die Grundlage, damit Fachkräfte dem Thema überhaupt gerecht werden können. Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr mit einer Begrüßung durch Sven Lehmann (Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, BMFSFJ). Im Anschluss daran gibt es einen Vortrag zum Thema „Lebenswelten queerer Jugendlicher“. Nach einer kleinen Pause können sich die Teilnehmer*innen dann entscheiden, ob sie an einem Forum zum Thema [Herausforderungen bei der] „Öffnung der Jugendhilfe für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ teilnehmen wollen oder an einem von drei Workshops mit den Themen: Nach einer Mittagspause wird es abschließend noch einen Impulsvortrag mit „Drei Handlungsanregungen für eine queersensible Kinder- und Jugendhilfe“ geben, bevor gegen 13:30 Uhr der Fachtag endet. Den genauen Ablauf mit allen Gastredner*innen und ihren Themen findet sich unter folgendem Link. Laut Veranstalter*innen richtet sich der Fachkongress bundesweit an alle Fach- und Leitungskräfte der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, medizinisch-therapeutischer Einrichtungen, aber auch juristischer Handlungsfelder und der Kindertagesbetreuung sowie allen weiteren für den Kinderschutz wichtigen Arbeitsfelder. Der Tagungsbeitrag beträgt 75 €. Studierende zahlen einen ermäßigten Beitrag von 40 €. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite. Dort gibt es auch den Link zum Anmeldeportal. Student*innen schicken hingegen ihre Anmeldung mit Immatrikulationsnachweis an folgende Mailadresse: anmeldung@kinderschutz-zentren.org
Weiterlesen Echte Vielfalt hatte dazu bereits im November 2022 berichtet. Das Eins-zu-eins-Mentoring richtet sich an Jugendliche und Jungerwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren aus Hamburg und Umgebung, die sich nichtheterosexuell und/oder nicht-cis-geschlechtlich fühlen oder dies gerade für sich herausfinden und sich eine Vertrauensperson wünschen, um diese Themen zu besprechen. Sie bilden als Mentees gemeinsam mit einer*m persönlichen queere*n Mentor*in (zwischen 18 - 29 Jahren) ein Tandem. Innerhalb des Tandems können die Mentees ihre Fragen stellen, sich austauschen, Bestärkung finden und sich vernetzen. Die Mentor*innen können ihre Mentees auf vielerlei Art bei der Identitätsfindung unterstützen. Sie können von eigenen Erfahrungen berichten, zuhören, das Selbstwertgefühl des Mentees stärken, ihr*ihm dabei helfen, sich besser zu verstehen, sich über queere Themen austauschen… Das Mentoring im Tandem ist für ein Jahr angelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Informationen gibt es bei Instagram, auf der Homepage sowie auf diesem Plakat: Peer4Queer sucht Mentees Das Plakat darf gerne ausgehängt oder anderweitig verbreitet werden!
Weiterlesen Die DAK schreibt: „Die Betroffenen fehlen häufiger in der Schule, haben mehr emotionale Probleme und geben deutlich mehr Geld aus.“ Insgesamt spielen dabei ungefähr 90 Prozent aller Jungen und fast 50 Prozent der Mädchen dieser Altersgruppe. Betrachtet man nur die Risikogruppe, sind ca. 79 Prozent Jungen und insgesamt 3,3 Prozent erfüllen sogar „[…] die Kriterien einer Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen, Kontrollverlusten oder Gefährdungen.“ Besonders problematisch dabei sind die Spielmechanismen, die gezielt auf Belohnungen ausgerichtet sind und damit die Gefahr einer Abhängigkeit verstärken. Dazu zählen u.a. Spiele, die sich unendlich erweitern, z. B. immer neue Ziele verfolgen, Möglichkeiten der Personalisierung von virtuellen Avataren oder Loot-Boxen (Belohnungen für Erfolg, Dauer, auch durch Geld). Gerade Loot-Boxen greifen dabei auf ähnliche Mechanismen wie Glücksspiele zurück. Doch wo liegt nun der Bezug zur LGBTIQ*-Gemeinschaft? Die Studie befragte 1.000 Jugendliche und rechnete dann die Zahlen auf die Gesamtbevölkerung hoch. Dabei wurde allerdings vorrangig zwischen Jungen und Mädchen unterschieden. Berücksichtigt man bei der Hochrechnung allerdings den Anteil an LGBTIQ*-Jugendlichen, so würden sich, nach Angaben des Magazin Schwulissiom, ca. 102.000 der rund 465.000 Risiko-Gamer*innen der LGBTIQ*-Gemeinschaft zuordnen. Schwulissimo betont weiter, dass gerade für LGBTIQ*-Jugendliche Aspekte wie ein unterdrücktes Coming-out, offene Fragen über die eigene Sexualität oder Identität, aber auch Mobbing- und Gewalterfahrungen verstärkend dazu beitragen können, Videospiele als Verdrängungsmethode zu nutzen. „So ist es gut möglich, dass die tatsächliche Zahl der spielsüchtigen LGBTIQ*-Jugendlichen weit höher liegt und einen überproportionalen Anteil an der gesamten Risikogruppe einnimmt.“ Aber auch grundsätzlich ist davon auszugehen, dass durch die dichotome Erfassung der Studie sowie den Umstand, dass einige der Befragten noch kein Coming-out hatten, ein Blindfeld besteht. Nichtsdestoweniger unterstreicht die Studie die Nutzung von Videospielen als Verdrängungsmethode: „29 Prozent der 12- bis 17-jährigen Computerspieler haben im vergangenen Jahr Spiele gespielt, um nicht an unangenehme Dinge denken zu müssen. Dies trifft auf die Mädchen etwas häufiger als auf die Jungen zu.“ Hier würde eine genauere Differenzierung evtl. helfen, könnte auf der anderen Seite aber auch die Gefahr einer falschen Pathologisierung mit sich bringen. Um es klar zu sagen: Das Problem sind nicht Computerspiele per se, ebenso wenig sind es die Gruppen, die ein besonderes Risiko aufweisen, ob LGBTIQ* oder andere. Das Problem besteht in den Spielmechanismen, die gezielt ihre Spieler*innen an sich binden und dazu auf suchterzeugende Methoden zurückgreifen. Diese Mechanismen treffen auf Strukturen, in denen gesellschaftliche bzw. sozialräumliche Probleme dazu führen, dass eine Flucht aus der Realität für einige Jugendliche nötig erscheint. Die eine Konsequenz ist also das von der DAK geforderte Verbot von Glücksspielelementen. Die andere Konsequenz bleibt jedoch die Frage, was sich hinter der Aussage verbirgt, „unangenehmen Dinge vergessen zu wollen" und das betrifft auch LGBTIQ*-Jugendliche, ob mit oder ohne Coming-out.