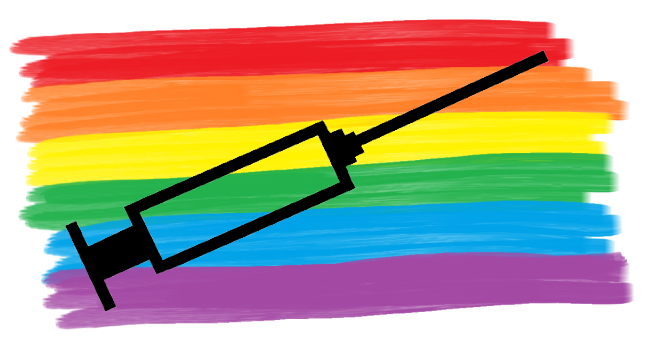Weiterlesen Die britische Regierung hatte grünes Licht für das Projekt gegeben und die benötigten 350.000 britischen Pfund bereitgestellt. Ein bedeutsames Signal für die LGBTQ+-Community des Landes, insbesondere da es sich beim National Arboretum um einen Ort handelt, der bisher die Dienste und Opfer der britischen Streitkräfte anerkannte, jedoch die homosexuellen Angehörigen ausschloss, so Schwulissimo weiter. Auch unabhängig von der persönlichen Meinung zu Militär und Krieg bleibt festzuhalten: Wenn sich Menschen als Soldat*innen für ihr Land verpflichten, obliegt dem Staat und den militärischen Führungskräften eine besondere Fürsorgepflicht. Dazu zählt auch der Schutz vor Diskriminierung innerhalb der Truppe. Dies ist ein ethisch gebotenes Minimum, wenn "man" als Staat Menschen in den Krieg oder lebensbedrohliche Einsätze schickt. In der Realität galt allerdings noch bis 1994 der §175, und selbst wenn dieser seit den 1950er Jahren in der Zivilgesellschaft nicht mehr zur Anwendung kam, galten in der Bundeswehr bis 1970 homosexuelle Handlungen als Dienstvergehen, die zu einer unehrenhaften Entlassung führen konnten. Bis 1979 war Homosexualität noch ein Ausmusterungsgrund. Im Jahr 2001 öffnete die Bundeswehr alle Laufbahnen auch für Frauen, 2006 wurde das Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten (SoldGG) erlassen. Es hat das Ziel, "Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den Dienst als Soldatin oder Soldat zu verhindern oder zu beseitigen" (§1 Abs. 1 SoldGG). Es dauerte allerdings noch bis zum Jahr 2020, bis die damalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sich offiziell für das Unrecht der Vergangenheit entschuldigt. Diese Entschuldigung haben die vergangenen Verteidigungsminister*innen bis zum aktuellen Boris Pistorius symbolisch wiederholt, wie das Bundesministerium der Verteidigung auf seiner eigenen Seite betont. Im Juli 2021 tritt dann letztendlich das "Gesetz zur Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuellen Orientierung oder wegen ihrer geschlechtlichen Identität dienstrechtlich benachteiligten Soldatinnen und Soldaten" (SoldRehaHomG) in Kraft. Damit haben Betroffene nun die Möglichkeit der Rehabilitation und Entschädigung wegen dienstrechtlicher Benachteiligungen. Außerdem werden wehrgerichtliche Urteile aufgehoben. Für Interessierte findet sich auf der Seite des LSVD eine genau chronologische Aufarbeitung der Ereignisse mit weiterführenden Links. Für Betroffene bietet die Seite der Bundeswehr ein umfangreiches FAQ an, dabei geht es unter anderem darum: Ebenso finden sich dort die Anträge für Rehabilitation und Entschädigung. Denkt man an vulnerable Gruppen, kommt einem selten die Bundeswehr in den Sinn. Aber gerade in stark hierarchischen Institutionen mit teilweise nach außen geschlossenen Strukturen und einem Nimbus, der die "Nicht-Vulnerabilität" propagiert, bleibt die Gefahr von unerkannter oder nicht geahndeter Diskriminierung und anderen Vergehen weiterhin ein Thema - auch mit einer Entschädigungsregel und dem Rehabilitationsgesetz im Hintergrund.
Schwule
Neue Regelungen der US-Gesundheitsbehörde für homo- und bisexuelle Männer beim Blutspenden
18. Mai 2023Weiterlesen Laut eines Berichts des Guardian lockern die am 11. Mai 2023 verabschiedeten Richtlinien der Food and Drug Administration (FDA) jahrzehntealte Beschränkungen, die die Blutversorgung vor HIV schützen sollten. Bis dato galt die sexuelle Orientierung als anerkannter Risikoindikator. Seit nun ca. acht Jahren vollzieht die FDA eine Kehrtwende in ihrer Gesundheitspolitik. Galt bis 2015 Homo- und Bisexualität bei Männern noch als Ausschlusskriterium, wurde in den Folgejahren das Blutspenden unter Abstinenzauflagen zugelassen, so das Magazin queer. Im Januar kündigte die FDA an, diese Auflage komplett zu kippen. Damit ist es schwulen und bisexuellen Männern in monogamen Beziehungen erlaubt, in den USA Blut zu spenden, ohne auf Sex verzichten zu müssen. Stattdessen sieht der neue Fragebogen für potenzielle Spender*innen vor, das individuelle HIV-Risiko unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung auf der Grundlage ihres Sexualverhaltens, ihrer letzten Partner*innen sowie weiteren Faktoren zu erfassen. Während laut Guardian die FAD sowie die NGO Human Rights Campaign (HRC) die neue Richtlinie als Schritt in die richtige Richtung bezeichneten, fügte die HRC im selben Atemzug hinzu, dass auch Personen, die PrEP (ein Medikament zur HIV-Vorbeugung) nehmen, die Spende möglich gemacht werden solle. Bereits Januar dieses Jahres hatte echte vielfalt in Bezug auf Deutschland über dieselbe Problemlage und den Mangel an Blutkonserven berichtet. Im März berichtete queer, dass der Deutsche Bundestag nun die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität als Ausschlusskriterium gekippt habe. Bis dato steht eine Richtlinienanpassung durch die Bundesärztekammer allerdings noch aus. Wichtig bei der ganzen Debatte ist, dass sowohl laut FDA für die USA als auch nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für Deutschland, alle Spenden grundsätzlich auf HIV, Hepatitis C, Syphilis und andere Infektionskrankheiten getestet werden. Mit dieser Praxis als Voraussetzung sollten sich die Gesundheitsbehörden die Frage stellen, ob sie mit ihrem Betonen einer weniger diskriminierenden Haltung beim Blutspenden trotz aller Progressivität nicht dennoch einen grundsätzlichen Fehler vollziehen. Dass in der Medizin immer wieder auch persönliche Fragen gestellt werden und dass diese Fragen dabei auch immer wieder zur Diskriminierung führen können, wird wohl zunächst ein gesellschaftlicher Balanceakt bleiben, an dem sich nicht nur direkt Betroffene weiterhin beteiligen müssen. Sollte aber der Mangel an Blutkonserven zu einem ernsthaften Problem werden, sollte der Grundsatz nicht heißen: „Ihr dürft jetzt auch wie alle anderen spenden." Sondern: „Bitte spendet Blut. Wie können wir es Euch recht machen?“
Weiterlesen Offenbar habe der deutsche Staatsbürger versucht, online einen Mann kennenzulernen. Russische Medien berichten davon, dass er ihn zu sich ins Hotelzimmer eingeladen habe. Fraglich bleibt, inwiefern dies als „Propaganda“ für Homosexualität zu verstehen ist. Bereits Anfang April wurde das Gerichturteil beschlossen. Nun soll er über die Türkei nach Deutschland gebracht werden. Die Rechte von LSBTIQ*-Personen sind in Russland stark eingeschränkt. Im Juni 2022 wurde ein seit 2013 bestehendes Gesetz verschärft, dass die „Werbung“ für Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit verbietet. Geld- sowie Haftstrafen können bei Verstößen folgen. Mit dem sogenannten „Gay Propaganda“ Gesetz werden queere Personen stark diskriminiert, in die Unsichtbarkeit und Illegalität gedrängt. Homo- und Queerfeindlichkeit kann öffentlich kaum mehr kritisiert werden, da Aktivist*innen mit hohen Repressionen rechnen müssen. Auf Basis des Gesetzes wurde unter anderem auch vor kurzem die Social-Media Plattform TikTok zu einer Geldstrafe verurteilt. Allein eine positive Darstellung von nicht-heterosexuellen Beziehungen kann rechtlich verfolgt werden, auch in Filmen und Büchern. So müssen auch Streaming-Anbieter und Verlagshäuser mit Verboten, Einschränkungen und Strafen rechnen. Wie echte vielfalt im Januar berichtete, wurden queere Personen auch zur Angriffsfläche in Putins diesjährigen Rede zur Lage der Nation. Das Feindbild des Westens würde traditionelle Werte zerstören. So wird der Ausbau von Rechten für Angehörige der LSBTIQ*-Community als Gefahr für die russische Bevölkerung konstruiert. Seit der Einführung des Gesetzes 2013 hat sich nach Angaben von Human Rights Watch die Situation für queere Personen verschlimmert. Unter anderem werden damit Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen verstärkt und ein queerfeindliches Klima im Land geschürt.
Disneys neuer Winterfilm mit schwulem Hauptprotagonisten: Eine progressive Entwicklung?
7. Januar 2023Weiterlesen Ähnlich sieht es auch bei LSBTIQ* Charakteren aus. Wie das Magazin queer aufzählt, waren sie meistens nur Randfiguren, die kurz auftauchen und dann wieder vergessen werden: „Ein schwules, verheiratetes Antilopen-Paar in "Zoomania", das erst bei genauem Lesen des Abspanns als solches zu erkennen ist, lesbische Elternpaare in "Findet Dorie" und "Toy Story 4", die ein paar Sekunden und ohne Dialog im Bild zu sehen waren. Viel mehr war da nicht.“ Im neuen Disney-Abenteuerfilm "Strange World" soll das Ganze anders sein: Der Film spielt im fiktiven Land Avalonia. Ausgangspunkt ist ein Bruch zwischen Claid und seinem Sohn Searcher während einer Entdeckungsreise. Der Sohn findet eine Pflanze, die das gesamte Energieproblem von Avalonia lösen kann und beschließt Farmer zu werden, während der Vater sich wieder auf Entdeckungstour begibt und verschwindet. 25 Jahre später ist Searcher ein erfolgreicher Farmer, der mit seiner Frau Meridian und seinem eigenen Sohn Ethan auf einer Farm lebt. Aber natürlich gibt es ein Problem. Eines Tages landet die Präsidentin von Avalonia auf der Farm und eröffnet Searcher, dass die Pflanze nicht mehr genügend Energie liefere. So machen sich Searcher und Ethan auf in ein eigenes Abenteuer, um das Problem zu lösen. Waren es bis jetzt Nebenrollen, so haben wir mit Ethan das erste Mal explizit einen Hauptcharakter, von dem wir erfahren, dass er in einen Freund aus seiner Clique verliebt ist. Queer schreibt dazu: „Dass dieser Jemand ein Junge namens Diazo ist, ist erfreulicherweise nicht das geringste Problem für Ethans Eltern. Und auch für sonst niemanden in "Strange World", schließlich geht es hier nicht um ein Coming-out, sondern um ein großes, gefährliches Abenteuer.“ Es ist also eine Hauptfigur mit normalen Teenagerproblemen wie Verliebtsein, ohne dass dabei die Sexualität zum Problem wird. Doch ist das tatsächlich der Fall. In seiner Filmanalyse bemerkt der Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt, dass gerade das Überzeichnete, mit dem Disney betont, dass niemand ein Problem damit habe, dass Ethan schwul sei und „wie selbstverständlich doch diese Selbstverständlichkeit ist“, die Frage aufwirft: Was steckt dahinter? Gerade bei Disney gilt es hier genau hinzuschauen. Wie Schmitt weiter bemerkt, lässt sich zwischen Ethan und seinem Schwarm Diazo keine einzige romantische Szene finden und auch sonst taucht Diazo nur für einige Minuten auf, um dann, wie schon die Nebencharaktere vor ihm, in der Versenkung zu verschwinden. Natürlich kann genau dies beabsichtigt sein, dass die Beziehung ohne weitere Romantisierung selbstverständlich im Hintergrund wirkt. Wäre es dann allerdings nicht viel selbstverständlicher gewesen, die beiden Jungen wären sich nähergekommen, ohne dass sich eines der Elternteile dazu genötigt gesehen hätte, das wortreich zu kommentieren? Nur weil etwas als selbstverständlich geäußert wird, steht dahinter noch lange keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr wirkt das Ganze, als wollen sich die Erwachsenen selbst überzeugen. Die Folge muss deshalb natürlich kein Boykott von Disneyfilmen sein, jedoch kann es nicht schaden, wie auch bei anderen Filmen, etwas genauer hinzusehen und sich nicht vom erstbesten Narrativ überzeugen zu lassen.
Neues aus den USA: Präsident Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen
23. Dezember 2022Weiterlesen Nach einem Zitat des Guardian betonte Biden in seiner Rede vor der Unterzeichnung, wie lange es gedauert habe und wie wichtig das Durchhaltevermögen derer gewesen sei, die immer an ein entsprechendes Gesetz geglaubt haben. Wie lang das wirklich war, macht eine Studie des Meinungsforschungsinstitutes GALLUP deutlich. Demnach lag noch 2004 die Zustimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe bei 42 %. Im Jahr 2022, also 18 Jahre später, stieg die Zustimmung auf 71 %. Die Studie zeigt zum Beispiel auch, dass der Anteil der Befragten, die wöchentlich die Kirche besuchen, besonders wenig Zustimmung aufwies (2004: 20 %). Im Jahr 2022 hat sich allerdings auch in dieser Gruppe die Zustimmung auf 40 % verdoppelt. Es lässt sich somit festhalten, dass die Haltung in den USA in diesem Bereich einen durchweg positiven Wandel durchlaufen hat. Wie wir allerdings bereits in unserem Artikel zur Verabschiedung des Gesetzes im Senat angemerkt hatten, ist mit dessen Eintreten zwar ein Ergebnis, aber noch kein Ende des Diskurses erreicht. Laut Forbes ist mit Gegenklagen zu rechnen, die in einem momentan sehr konservativen „Supreme Court“ durchaus Gehör finden könnten. In älteren Urteilen hatte sich der Oberste Gerichtshof der USA allerdings bereits unterstützend den Rechten einer nicht gleichgeschlechtlichen Ehe gegenüber verhalten. Auf der Webseite des US-Kongresses wird in einer Stellungnahme zum Gleichstellungsgesetz deshalb immer wieder auf entsprechende Urteile verwiesen. Zweck des Gesetzes ist es letztendlich, das Bundesrecht dahingehend anzupassen, dass jeder Wortlaut der Ehe als Vorgang zwischen „Mann und Frau“ durch „zwischen zwei Personen“ ersetzt wird. Ein entsprechendes Urteil des Supreme Court gab es bereits 2013. Weiter werden alle Klauseln, die nicht zwingend verlangen, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen, durch die Pflicht zur vollumfänglichen Anerkennung der Ehen und der daraus resultierenden Rechtsansprüche ersetzt. Auch hier hatte der Supreme Court bereits 2015 auf die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen hingewiesen, die gleichgeschlechtliche Ehen verbieten. Mit dem jetzt unterzeichneten Gesetz haben nun nicht nur die Betroffenen, sondern auch das Justizministerium die Möglichkeit, bei Verstößen Klage einzureichen. Einschränkungen in der Reichweite bestehen hingegen in Bezug auf die religiöse Freiheit und den Gewissensschutz und damit verbundene Dienstleistungen. Damit ist keine Institution dazu verpflichtet, eine Ehe zu vollziehen. Ebenso betrifft das Gesetz keine Vorteile oder Rechte, die sich nicht aus einer Ehe ergeben. Wie sich das ganze weiterentwickelt, muss nun die Praxis zeigen.
WorldPride 2023 in Sydney: Die Vorbereitungen laufen
10. November 2022Weiterlesen Die WorldPride wird grundsätzlich unter den Mitgliedern der Dach-NGO InterPride ausgeschrieben und von dieser lizenziert. Bei InterPride handelt es sich um ein Netzwerk von 400 Organisationen aus mehr als 70 Ländern, das global bei der Koordination von Prides unterstützt. Mit Sydney wird 2023 zum ersten Mal eine Stadt der südlichen Hemisphäre ausgewählt, heißt es auf der offiziellen WorldPride Webseite. Daher findet das Festival auch nicht wie sonst im Juni, sondern bereits vom 17. Februar bis zum 5. März 2023 statt. „Der Sydney WorldPride umfasst alle beliebten Veranstaltungen des schwul-lesbischen Karnevals in Sydney sowie ein breit gefächertes Festivalangebot in den Bereichen Kunst, Sport, Theater, Konzerte, Partys, Programme für die Ureinwohner und eine Menschenrechtskonferenz.“ Auch ohne die Veranstaltung der WorldPride ist Sydney für seinen „Schwulen und Lesben Karneval“ bekannt. Ungeachtet des irreführenden Namens handelt es sich beim „Gay and Lesbian Mardi Gras“ (SGLMG) um eine gemeinnützige, mitgliederbasierte LGBTQIA+ Organisation, die neben dem Karneval auch verschiedene andere Veranstaltungen und unterstützende Initiativen im Laufe des Jahres organisiert. Somit mag die WorldPride zwar von Februar bis März stattfinden, die Veranstaltungen rundherum beginnen allerdings bereits im Januar. Wer Interesse hat, vielleicht auch nur als Inspiration, findet im Anschluss an diesen Artikel eine Liste aller Veranstaltungen im Zuge der WorldPride 2023. Neben vielen künstlerischen Veranstaltungen wird zudem vom 1. bis 3. März eine Menschenrechtskonferenz stattfinden. Das Programm der Konferenz beinhaltet neben Vorträgen von über 60 lokalen und internationalen Redner*innen auch Podiumsdiskussionen und interaktive Workshops. „Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinschaft aus der ganzen Welt werden zusammenkommen, um die großen Themen anzugehen, mit denen die LGBTQIA+-Gemeinschaft konfrontiert ist, und die Fähigkeiten und Netzwerke zu entwickeln, die einen positiven Wandel bewirken.“, heißt es auf der Seite der Veranstalter*innen. Mit Ticketpreisen von 147 australischen Dollar, also umgerechnet ca. 95€ ist die Konferenz allerdings nicht unbedingt als niedrigschwellig anzusehen. Die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme ist auf der Webseite leider nicht ersichtlich. Gerade in den letzten Jahren ist es allerdings üblich geworden, Podiumsdiskussionen und Vorträge zu streamen und bei YouTube hochzuladen. Link zur Webseite der WorldPride 2023 und direkt zu den Veranstaltungen Link zur Webseite der Sydney WorldPride Menschenrechtskonferenz Link zum Gay and Lesbian Mardi Gras Link zur Dachorganisation InterPride
Würden die Veranstaltenden hinter diesen Standard zurückfallen, wäre das nicht nur schade, sondern würde auch dem Anspruch, „einen positiven Wandel" bewirken zu wollen, kaum gerecht werden.
Filmtipps: ‚Mutter Mutter Kind‘ und ‚Bodies Bodies Bodies‘
29. Oktober 2022Weiterlesen Die Langzeit-Doku ‚Mutter Mutter Kind‘ begleitet die Protagonist*innen seit 2009 ca. 13 Jahre lang und gibt somit nicht nur Einblicke in das Leben der Familie, sondern zeigt darüber hinaus die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in dem Zeitraum ereignet haben und mit denen Anny und Pedi und ihre Kinder konfrontiert sind. „Es war mir wichtig, die privaten Erlebnisse unserer Protagonisten in einen zeitgeschichtlichen Kontext zu stellen und auch den Umgang mit Homosexualität in Deutschland international zu verorten“, zitiert der Freitag Annette Ernst, die Regisseurin des Films. Der Film beginnt kurz vor der Geburt des dritten Sohnes von Anny und Pedi zu einer Zeit, in der die beiden Frauen noch mit einer Annonce nach einem passenden Samenspender suchen mussten. Annette Ernst und Kamerafrau Nina Werth wollten mit ihrem Film Antworten auf vorurteilsbeladene und hoch umstrittene Fragen finden. Zum einen: „Fehlt den Kindern bei gleichgeschlechtlichen Eltern das jeweils andere Geschlecht?" Und zum zweiten: „Darf man den Kindern zumuten, eine Sonderrolle zu spielen?“ (hessenschau) Das Magazin L-Mag kritisiert hingegen die problembeladene Sicht des Films und hätte sich angesichts des umfassenden Rohmaterials und der „prächtige[n] Entwicklung der porträtierten Regenbogenkinder“ eine positivere Betrachtungsweise gewünscht: „Die Doku lässt viele spannende Themen liegen.“ ‚Bodies Bodies Bodies‘ der holländischen Regisseurin Halina Reijn ist ein Generation Z-Film im typischen Slasher-Comedy-Style: Eine Gruppe von sieben rund 20-jährigen ‚Rich Kids‘ verbringt ein Wochenende auf einem abgelegenen Anwesen. Ein Mord-im-Dunkeln-Spiel entpuppt sich dabei als bitterer Ernst mit mehreren echten Leichen… Ein aufziehender Hurrikan mit Strom- und Netzausfall tut sein Übriges. Auch wenn diese Art Geschichte nicht wirklich neu ist und bereits in diversen Filmen umgesetzt wurde, besteht das Besondere hier aus „immer aggressiver werdenden Anspannungen und Sticheleien innerhalb der toxischen Gruppendynamik, deren Gespräche wie aus einem Twitter-Thread entnommen wirken.“ (moviebreak). Damit zeigt sich ‚Bodies Bodies Bodies‘ als „Genre-Parodie und als Sozialsatire auf Gen Z-Kids, ihre Werte und ihre Freundschaften“ (L-Mag). Überzeugend spielen zudem Amandla Stenberg und Maria Bakalova ein junges lesbisches Paar, das – anders als häufig in Filmen – ganz selbstverständlich zueinander findet. Stenberg ist im echten Leben offen Bi und setzt sich für LGBTIQ* Rechte ein (hier ein interessantes Interview mit ihr). Ein weiterer Hauptdarsteller, Lee Pace, der im Film zwar einen heterosexuellen Part spielt, gab im August bekannt, seinen langjährigen Freund geheiratet zu haben. Trailer ‚Mutter Mutter Kind‘ Trailer ‚Bodies Bodies Bodies‘
Terror in Bratislava zeigt den strukturellen Ursprung von Hass und Gewalt gegen LGBTIQ+
25. Oktober 2022Weiterlesen Im Licht dieses Ereignisses verabschiedete das Europäische Parlament am 20. Oktober eine Resolution, in der es die Tat als rechtsextremen Terrorakt bezeichnete und zutiefst verurteilte. Gleichzeitig zeigte es sich „besorgt über die Straflosigkeit, mit der LGBTIQ+-feindliche Gruppen und insbesondere rechtsextremistische Gruppen in einigen Mitgliedstaaten agieren“. Im aktuellen Fall hatte sich der Schütze sowohl an der White-Supremacy-als auch an der Incel-Ideologie orientiert. Das Parlament bestätigt damit, dass die Tat kein Einzelfall war, sondern ihren Ursprung in den ideologischen bis hin zu rechten LGBTIQ+-feindlichen Strukturen hat. Wie die Magazine Schwulissimo und Queer berichten, sei die Resolution mit 447 zu 78 Stimmen und 45 Enthaltungen verabschiedet worden. Dabei kamen die Neinstimmen vor allem von Vertreter*innen aus Ungarn, Polen und Italien. Dass es sich hierbei auch um ein strukturelles Problem handelt, macht ein Blick zurück in den März 2021 deutlich: Damals stellte das Europäische Parlament fest, dass es einen deutlichen Rückschritt bei den Rechten von LGBTIQ+ Personen gebe, der vor allem in Ungarn und Polen zu beobachten sei. In diese Situation von Hetze und Desinformation seinen auch Amtsträger*innen und Behörden involviert, heißt es. Auch in der Slowakei ist die Gesetzgebung weit hinter einem effektiven Schutz und Gleichbehandlung von LGBTIQ+ Personen zurück, daran ändert nichts, dass sich die Präsidentin und der Ministerpräsident solidarisch mit den Opfern zeigten. Dabei verstoßen die Länder in ihrer Ignoranz bis hin zur aktiven Beschneidung von Rechten nicht „nur“ gegen ethische Prinzipien oder die „Allgemeine Menschenrechtserklärung“. Stattdessen missachten alle Länder, die sich LGBTIQ+ feindlich verhalten, eindeutig europäisches Recht. In ihrer letzten Resolution verweisen die Parlamentarier*innen zuallererst auf die eigenen Grundrechte der EU, um sofort im Anschluss Bezug auf Art. 2 EUV zu nehmen, den Vertrag über die Europäische Union. Hierin stellt die EU klar, dass ihre Gründungswerte die „Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören“, und allen Mitgliedstaten gemein sind. Bereits in der Vergangenheit hatte die EU sowohl Ungarn als auch Polen mit Sanktionen belegt, weil diese gegen die Grundwerte verstoßen hatten. Das Parlament ist sich der strukturellen Ursachen sehr bewusst. Ob die Sanktionen allerdings wirklich zu einer Verbesserung für die LGBTIQ+ Community in den einzelnen Mitgliedstaaten führen, bleibt abzuwarten. Die Mühlen mahlen langsam und bis dahin und darüber hinaus braucht es immer wieder die Stimmen der Zivilgesellschaft.
Weiterlesen In einem früheren Artikel haben wir bei echte-vielfalt.de über die Situation und was sie für LSBTIQ* Besucher*innen sowohl aus dem Ausland als auch aus Katar bedeuten kann, berichtet. Nun spitzt sich die Lage zu. Nach einer Zusammenfassung des Magazins Schwulissimo sollen Filmaufnahmen in Privaträumen, Universitäten, Krankenhäusern sowie bei Unternehmen verboten werden. Gerade die erste Einschränkung erschwert es, hinter die Kulissen zu schauen. Damit betrifft diese Medienzensur zwar alle, allerdings bedeutet sie gerade für gefährdete Personen „Unsichtbarkeit“ in Sinne des Wortes. Der Tagesspiegel merkt an, dass übertragende Medien wie ARD und ZDF oder auch die Telekom Magenta TV immer wieder versichert hatten, auch über die vorherrschenden Zustände berichten zu wollen. Dies wird ihnen nun zumindest massiv erschwert. Aber damit nicht genug: Wie der Stern mit Verweis auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus Norwegen "NRK" berichtet, ist jede*r Besucher*in dazu verpflichtet eine App herunterzuladen, die weitreichende Zugriffe auf die privaten Daten erhält. Die App sei von einem „Trojaner“ kaum zu unterscheiden, so der Stern. Der NRK fasst zusammen: „They can simply change the contents of your entire phone and have full control over the information that is there.” Aus diesem Grund empfiehlt der norwegische Rundfunk, ein leeres bzw. neues Handy mitzunehmen, wenn man das Land besuchen möchte. Eine App, die einen fast uneingeschränkten Zugang hat, kann nicht nur auf vorhandene Daten zugreifen, sondern prinzipiell auch Gespräche. Wie schon in unserem vorherigen Bericht gilt hier: „Während die WM-Tourist*innen nach den Spielen das Land verlassen, bleibt das Gesetz gegen Homosexualität für die Menschen in Katar auch nach der WM, wenn die Welt nicht mehr zuschaut, bestehen.“ Und es ist unklar, welche Erkenntnisse die Führung in Katar über einige ihrer Bürger*innen daraus zieht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hingegen kündigte an, „vor Ort die Sicherheit von queeren Fans während des Turniers [zu] thematisieren.“ Sie wolle dafür zusammen mit der Menschenrechtsbeauftragten Luise Amtsberg (Grüne) sowie dem Eventmanager Bernd Reisig (Initiative "Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar") Ende Oktober nach Katar reisen. Bereits zuvor hatte Faeser gefordert, „bei künftigen internationalen Sportevents […] bereits die Vergabe ‚an menschenrechtliche Standards‘" zu knüpfen, lehnte einen Boykott der WM jedoch ab.
Queere Fotografie – Berlin – bis 18.01.2023
28. September 2022Weiterlesen "[...] Von historischem Bildmaterial, das den Akt des Fotografierens als Akt der Identitätsfindung zeigt, über einen einzigartigen Safe Space bis hin zu zeitgenössischen Ausdrucksformen von Geschlechterfluidität, welche die Frage aufwerfen, ob sozial konstruierte Geschlechter heutzutage überhaupt noch zeitgemäß sind.“ (Beschreibung C/O Berlin) Gute Kunst kann bzw. soll triggern und Emotionen hervorrufen, man sollte also genügend Zeit mitbringen, die Kunst wirken zu lassen und mit den Emotionen umzugehen. Ausstellungen können einen habituellen Anstrich haben, nicht jede*r fühlt sich in ihrer Umgebung wohl. Der Auftritt der Webseite kann Hinweise auf die Bildsprache der Ausstellung geben, es lohnt sich also ein Besuch der Homepage. Die schwarz-weiß-Ästhetik und die Sepiatöne alter Fotografien bilden einen interessanten Kontrast zu der häufig farbenfrohen Darstellung der LSBTIQ* Community. Dieser Kontrast kann verdeutlichen, dass LSBTIQ* mehr ist als bunt und dass sich auch mit zurückhaltenden Tönen Statements setzen lassen. Die Ausstellung ermöglicht einen punktuellen Blick in die Vergangenheit und ihre damalige Fototechnik. Die Betrachter*innen erlangen einen Blick in das Verborgene und Private von Menschen, die die Fotografie für ihre Selbstdefinition entdeckten. Wer Interesse hat: Am 01.10.2022 findet eine Führung des Gastkurators Sébastien Lifshitz statt. Lifshitz ist Fotograf einer der drei Ausstellungen. Seine Sammlung zeigt Fotografien des vergangenen Jahrhunderts und darüber hinaus, die er über Jahre auf Flohmärkten zusammengetragen hat. Er zeigt Menschen, die sich durch Kleidung ihre eigene Identität erschaffen, um sie in der Fotografie zu verstetigen. Ein Thema, das bis heute aktuell ist. Die Ausstellung bildet damit eine komplementäre Ästhetik sowie ein Fenster in die Vergangenheit. Vielleicht auch etwas für Personen, die sich ansonsten weniger von LSBTIQ* Themen angesprochen fühlen. Informationen und Begleitprogramm: „Queerness in Photography“