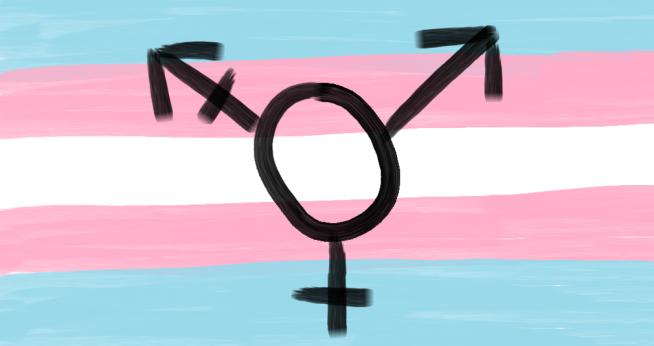Mein Kind stellt seine Geschlechtsidentität in Frage. Wie kann ich damit umgehen? Diese Frage stellt sich Carolyn Tate in der Elternschafts-Kolumne „Sharing the Load“ der britischen Zeitung the Guardian. Sie schreibt: „Jetzt, fünf Jahre später, ist mir das völlig klar – und mein Sohn ist der glücklichste, den ich seit seiner Kindheit gesehen habe“. Doch der Weg dahin hätte besser gelingen können.
Es ist seltsam, das Kind, das man benannt und großgezogen hat, plötzlich mit einem anderen Namen anzureden und die Pronomen zu wechseln, aber es wird viel schneller normal, als man denkt, schreibt Tate. „Und es half mir zu erkennen, dass es hier um Connor ging und nicht um mich.“
Als ihr Sohn Connor ihr zum ersten Mal erzählte, dass er trans ist und nicht die Tochter ist, für die sie ihn die ersten 12 Jahre seines Lebens gehalten habe, hätte sie es viel besser machen können, bereut sie. Es ist nicht so, dass sie getreten und geschrien hätte, sondern schlimmer: „Ich habe ihm nicht geglaubt“. Als Connor ihr zum ersten Mal erzählte, dass er sich für einen Jungen hielt, hatten sie beide mehr als ein Jahr lang nach Antworten für den Grund seiner Angstzustände und Depressionen gesucht. Sie dachte, er klammere sich vielleicht an einen Strohhalm und suche nach einer einfachen Erklärung dafür.
Heute, fünf Jahre später, ist ihr klar, dass Connors Probleme mit der psychischen Gesundheit eng mit dem Gefühl verbunden waren, dass sein inneres Gefühl nicht zu seinem Körper und seiner Geschlechtsidentität passte. Als ob er in einer Lüge gefangen wäre. Aber zu der Zeit konnte Carolyn Tate das nicht sehen. Sie sagte Connor, dass sie ihn liebte und dass sich das nie ändern würde, egal was passiert. Aber sie suchte weiter nach anderen Gründen für seine Ängste und Depressionen. Etwa sechs Monate lang, nachdem er sich geoutet hatte, benutzte sie auch seinen Deadname (den weiblichen Namen, den sie ihm bei seiner Geburt gegeben hatte) und misgenderte ihn mit weibliche Pronomen (sie/ihr statt er/ihn).
Heute ist ihr klar, dass sie ihm einfach hätte glauben und ein Umfeld der Akzeptanz hätte schaffen sollen, und „ich wünschte, ich hätte das sofort getan“, schreibt Tate. Doch sie habe sich so sehr mit all den „Was wäre wenn“-Fragen beschäftigt: Was ist, wenn er seine Meinung ändert? Was, wenn die Leute ihm das Leben schwer machen? Was ist, wenn seine jüngeren Geschwister verwirrt sind? Was, wenn ich mich komisch oder unwohl fühle? Die Antwort auf all diese Fragen lautet natürlich: „Wen kümmert’s?“. Er hat seine Meinung nicht geändert, aber wenn er es getan hätte, hätte es nichts gekostet und „wir hätten weitergemacht“. Schon in der Schule wurde er gemobbt, und daran hat sich nichts geändert, aber er ist ein zäher Bursche und hat gelernt, sich mit liebevollen Freunden zu umgeben und damit umzugehen. „Mit seinen 17 Jahren ist er tatsächlich einer der widerstandsfähigsten Menschen, die ich kenne.“
„Vielleicht habe ich meine Chance verpasst, für ihn da zu sein, als er mich vor fünf Jahren brauchte, aber der Weg ist lang und ich lerne ständig dazu“, beendet Carolyn Tate ihren berührenden Essay. Lesen Sie ihn hier auf Englisch ganz.