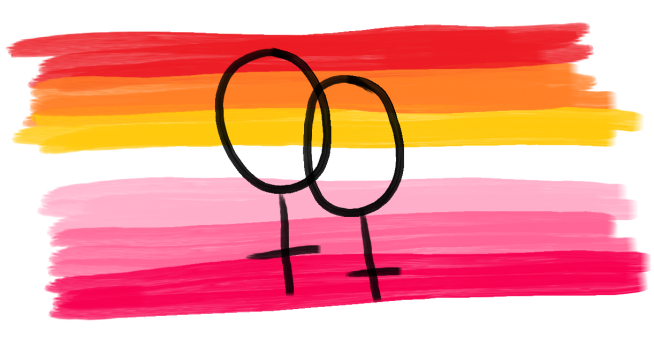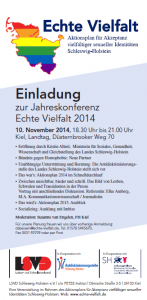Zur Eröffnung in Heide betont Ministerin Alheit in einem Grußwort:
„Westküste denkt QUEER“ - das werden ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate sein – die aber einem gemeinsamen Nenner haben: Es geht um Information und Aufklärung über die Vielfalt sexueller Identitäten. Es geht darum, Wissen über und Akzeptanz von unterschiedlichen Lebens- und Liebesweisen zu einer Selbstverständlichkeit zu machen – die es nach wie vor nicht ist. Das ist eine Aufgabe, die hier an der Westküste und die überall im Land wichtig ist. Und von der ich mir wünsche, dass noch viel mehr Menschen sich beteiligen und Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz setzen. Es geht darum, Menschen in ihren ganz unterschiedlichen Identitäten und Orientierungen den Respekt zu erobern, der ihnen wie allen Menschen zusteht.
Ganz gleich, ob sie dem entsprechen, was manche als „Normalität“ auffassen. Dieses noch unerfüllte Anliegen betrifft nicht nur Menschen mit einer trans- oder intersexuellen Identität. Abwehr und Aggression treffen und betreffen alle Menschen, die nicht-heterosexuell leben und lieben. Für sie gehören offene oder unterschwellige Homophobie nach wie vor zum Alltag. Diese Feindseligkeit hat viele Facetten und Ausdrucksformen. Von Diskriminierungen, Beleidigungen, Mobbing bis hin zu Hassparolen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.
Und es gibt immer noch gesellschaftliche Bereiche, in denen Schwule, Lesben und Transidente mit Verleugnung der eigenen Persönlichkeit leben müssen. Das gilt für den Profisport ebenso wie für Menschen in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Aber eben auch für ganz viele Menschen in nicht prominenter Lage. Das ist eine fast absurde Situation in einer Gesellschaft, in der heterosexuelle Identitäten als Selbstverständlichkeit gelebt und offen zur Schau gestellt werden. Etwa von Paaren, die händchenhaltend flanieren; oder von Kolleginnen, die auf der Arbeit von ihrem Freund erzählen; oder Politikern, die Frau und Kinder als Wahlargument präsentieren.
All das soll niemandem ausgeredet werden. Wenn aber lesbische, schwule, trans- und intergeschlechtliche Personen dafür eintreten, dass sie berücksichtigt werden, dass ihre Existenz sichtbar gemacht wird – dann wird das teilweise regelrecht als Angriff interpretiert. Menschen, denen die Allgegenwärtigkeit von Hetero-Sexualität so gar nicht auffällt, verwahren sich dann – und eben nur in diesem Zusammenhang – gegen vermeintliche „Sexualisierung“. Dabei geht es um etwas ganz anderes: Um das Anliegen, in seiner Identität gesehen und akzeptiert zu werden. Und dieses Anliegen ist doch so normal wie nur irgendetwas und so berechtigt wie nur irgendetwas.
Weil dies aber noch keine Selbstverständlichkeit, sondern überall eine Herausforderung ist, haben wir in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr einen Aktionsplan auf den Weg gebracht: Als Landesregierung mit dem Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein e.V, dem ich bei der Gelegenheit nochmal ausdrücklich danken möchte und weiteren Partnern. „Echte Vielfalt, Aktionsplan zur Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten“ umfasst Aktivitäten und Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen:
Sei es Initiativen der Landeregierung für die noch ausstehende rechtliche Gleichstellung nicht-heterosexueller Lebensweisen. Seien es Aktivitäten, die Akzeptanz unterschiedlicher Identitäten noch stärker in der Gesellschaft verankern, die Vorurteile und Homophobie zurückdrängen. Wesentliche Zielsetzung für die nachhaltige Wirkung des Aktionsplans ist dabei insbesondere die enge Kooperation mit den landesweit und regional engagierten Akteuren. Dabei sind in relativ kurzer Zeit richtig gute und anspruchsvolle Maßnahmen auf den Weg gebracht worden.
Zum Beispiel wurde die Informations- und Aufklärungsfibel produziert; eine Foto- Aktion, die auf dem Kieler CSD ganz viel Anklang gefunden hat, auch auf den CSDs in Lübeck und Neumünster angeboten und wurde das „Bündnis gegen Homophobie“ gegründet. Mit 11 Unternehmen, Vereinen und Verbänden als Erstunterzeichner der “Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Respekt”. Akzeptanz sexueller Vielfalt lässt sich nicht verordnen. Es bedarf eines engagierten Miteinanders aller gesellschaftlich relevanten Gruppen. Das ist Leitlinie der Landesregierung. Wir wollen – gemeinsam mit den Akteuren – einen Kulturwandel in der Gesellschaft: hin zu mehr Sensibilität für Vielfalt, hin zu einer Sensibilisierung der Menschen dafür, was Diskriminierung im Alltag ausmacht und wie diese zu überwinden ist. und auch: Hin zu einem Klima, in dem LSBTI-Menschen offen und mit Selbstbewusstsein auftreten können als die Menschen, die sie sind und die sie sein wollen. Mir kommt es darauf an, „Echte Vielfalt“ nicht nur in Drucksachen und Broschüren, sondern vor allem im Bewusstsein der Menschen im Land voranzubringen. Dafür braucht es ein breites gesellschaftliches Bündnis.
Deshalb ist es mir wichtig, nach dem guten Start des Aktionsplans mit den Akteuren weitere Pflöcke einzuschlagen für echte Vielfalt im „Echten Norden“.
Die Initiative „Westküste denkt QUEER“, die sich hier im vergangenen Jahr gegründet und richtig breit aufgestellt hat, ist ein tolles Beispiel dafür, worum es geht und wie das geht. Sie will hier an der Westküste über vielfältige sexuelle Identitäten aufklären, will Akzeptanz fördern, will Ängste und Berührungsängste abbauen. Das unterstütze ich gerne und es zeigt mir, dass die Initiative für den Aktionsplan „Echte Vielfalt“ im vergangenen Jahr kein Strohfeuer war, sondern überall im Land Menschen sind, die das selbst wichtig finden und befördern wollen.
Ich wünsche mir, dass die bestehende Vielfalt in Schleswig-Holstein sichtbar und einer breiteren Öffentlichkeit vertrauter wird. Ich weiß, dass das auch Durchhaltevermögen und eine gewisse Zähigkeit braucht. Wobei die den Menschen gerade hier an der Westküste ja nicht zu Unrecht nachgesagt wird!
Heute ist der Auftakt zu einem tollen Programm, das hier in recht kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, das zu ermöglichen.
Ich wünsche Ihnen für die Veranstaltungsreihe breites Interesse und gute Begegnungen mit Menschen, die sich anstoßen lassen, sich gedanklich zu bewegen. Und dabei – im Sinne des Titels – auch „queere“ Gedanken zuzulassen.“
Schließen