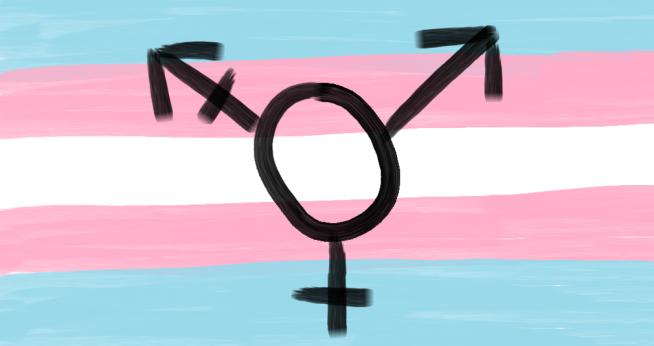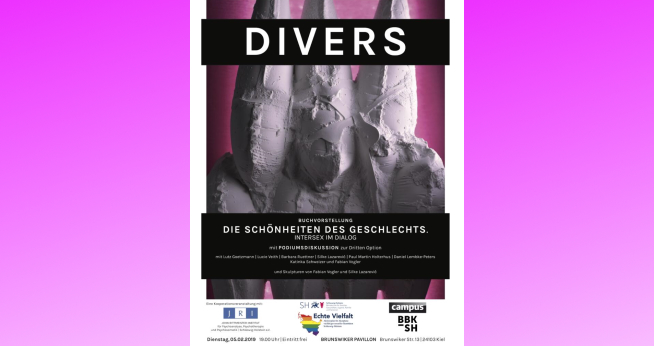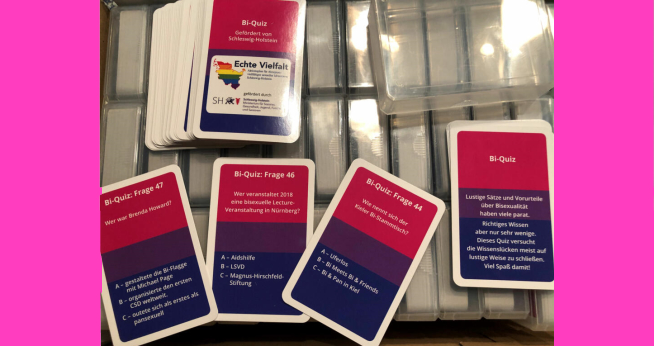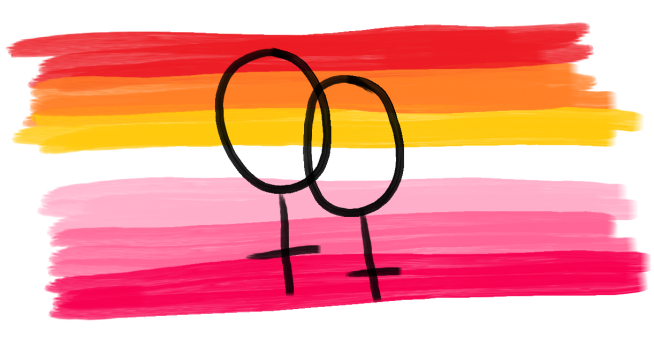Wie auch in den letzten Jahren werden wir Euch in den zwei Wochen vor dem Kieler CSD eine Fülle an Aktivitäten und Veranstaltungen anbieten, um die Wartezeit auf den CSD zu verkürzen. Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung der Termine:
Weiterlesen
Mittwoch, 27.06.2018
Die CSD Woche beginnt mit einer Themenveranstaltung zum diesjährige Motto "Queere VielfALT - ein Leben lang". Im AWO Servicehaus in Kiel (Ecke Alte Lübecker Chaussee / Theodor-Heuss-Ring) um 19:00 Uhr werden Raingard Wagner vom Dachverband Lesben und Alter e.V. sowie Alexander Popp von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e.V. ihren jeweiligen Verein vorstellen und zu den Fragen Antworten finden, was eigentliche bei queeren Senior*Innen anders ist.
Am Abend zeigt das Traumkino den höchst aktuellen Film "Battle of the Sexes". Vorstellungsbeginn ist 20:00 Uhr und der Eintritt kostet 4,90 €.
Donnerstag, 28.06.2018
Die Regenbogensportgruppe organisiert eine Kanu-Tour auf der Eider für alle Interessierten aller Altersstufen. Treffplatz ist der Wilhemplatz um 18:30 Uhr.
Freitag, 29.06.2018
Der CSD Kiel e.V. organisiert einen weiteren Spieleabend in den Räumen der Haki. Es ist jeder willkommen, der einmal mehr ausprobieren möchte als eine Runde Monopoly oder Risiko, Beginn ist um 19 Uhr.
Samstag, 30.6.2018
Es findet eine Lesung von Frank Thies in den Räumen der Haki statt, Beginn ist um 16:00 Uhr.
Am Abend haben wir gleich zwei Veranstaltungen für Euch: Jeweils um 20:00 Uhr beginnen die Schlager-Nacht im Harlekin und der Karaoke Abend im Birdcage. Der Eintritt ist jeweils frei.
Sonntag, 01.07.2018
Wir freuen uns, zusammen mit dem Traum Kino den Film "The Happy Prince" vorführen zu können. Vorstellungsbeginn ist um 17:45 Uhr im Traum Kino, der Eintritt kostet 6,50 €.
Montag, 02.07.2018
Zum zweiten Mal findet im Studio Kino das Event "Queer-verguckt" statt, bei dem sich queere Singles näher kennen lernen können. Beginn ist um 20:30 Uhr, der Eintritt kosten 10,00 € inkl. einem Freigetränk.
Dienstag, 03.07.2018
Wie es mittlerweile eine schöne Tradition ist, lädt die Stadt Kiel anlässlich des Kieler CSD zum Empfang im großen Saal im Rathaus. Beginn ist um 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.
Mittwoch, 04.07.2018
Im Harlekin findet der "Abend der Kurzen" statt - diverse "Kurze" gibt es dann für 1 €. Beginn ist um 20:00 Uhr.
Donnerstag, 05.07.2018
Die Regenogensportgruppe lädt ein zum Grillen am Strand. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr auf dem Wilhelmplatz in Kiel. Grillgut sollte selbst mitgebracht werden.Das Birdcage veranstaltet die allmonatliche "L-Night - women only". Beginn ist um 20:00 Uhr.
Freitag, 06.07.2018
Das Traum Kino zeigt anlässlich des CSD den Film "Stonewall". Vorstellungsbeginn ist um 20:00 Uhr, der Eintritt kostet 6,50 €.Daneben veranstaltet das Queerreferat im Subrosa in Kiel die "queere Eskalation". Der Eintritt zur Party ist kostenfrei und diese startet um 21 Uhr.
Samstag, 07.07.2018
Demonstration
12:00 Uhr
Endlich ist es soweit - der CSD Kiel 2018 startet! Die Demonstration anlässlich des CSD Kiel beginnt um 12:00 Uhr auf dem Asmus Bremer Platz in der Kieler Einkaufsstraße. Die genaue Route wird hier noch bekannt gegeben. Diese wird sich aufgrund der Baustelle auf der Holstenbrücke minimal ändern müssen.
Samstag, 07.07.2018
Straßenfest
13:30 Uhr
Das Straßenfest des 21. Christopher Street Day in Kiel wird um 13:30 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz stattfinden. Wir auch im letzten Jahr haben wir ein buntes Programm für Euch zusammengestellt und es werden besondere Gäste auf der CSD-Bühne erscheinen.
Neben dem musikalischen Spektakel darf aber auch der Grund für den CSD nicht ins Hintertreffen geraten. Daher könnt Ihr Euch auf feurige Reden auf der CSD Bühne einstellen. Unter anderem werden unser Schrimherr, der Sozialminister Dr. Heiner Garg sowie Daniel Lembke-Peters von der Geschäftsstelle Echte Vielfalt auf der Bühne präsent sein.
Damit Euch davor nicht langweilig wird, öffnet das Birdcage seine Türen bereits um 15 Uhr für Euch und das Harlekin veranstaltet einen Grillabend ab 18 Uhr.
Samstag, 07.07.2018
Abschlussparty
21:00 Uhr
Zusätzlich können wir Euch auch noch einen Wahnsinns-Act präsentieren. Gloria Glamour wird direkt vor der Disco um 21 Uhr im Roten Salon in der Pumpe Ihre Travestishow aufführen. Karten hierfür bekommt Ihr am CSD-Stand oder an der Abendkasse.
Abends findet dann die CSD Abschlussparty in der Pumpe statt. Diese beginnt um 22:00 Uhr.
Sonntag, 08.07.2018
Wenn Ihr nach der Abschlussparty noch nicht genug habt, öffnet das Birdcage für Euch bereits um 05:00 Uhr die Pforten zum Frühshopen.
Am Abend werden die CSD Wochen dann traditionell vom CSD Gottesdienst in der Nikoleikirche beendet. Dieser beginnt um 17 Uhr und ist offen für alle Konfessionen und auch für Konfessionslose.
Schließen