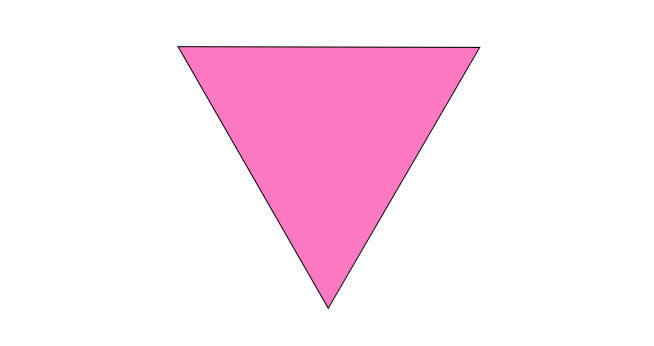Aromantik und queer-platonische Beziehungen
8. Februar 2021Weiterlesen Für sie sei es nie das richtige gewesen: Caro (25) habe tatsächlich viele klassische, romantische, und wie sie sagt, „einengende“ Beziehungen geführt, bis sie in der queeren Community in einem Tumblr-Post etwas über Aromantik las – „und dann hat es einfach Klick gemacht“: Sie ist auf dem sogenannten Ace/Aro-Spektrum, welches Personen einschließt, die asexuell und/oder aromantisch sind. Während Asexualität bedeutet kein oder wenig Verlangen nach Sexualität mit anderen Menschen zu haben, bezieht sich Aromantik darauf keine klassische, romantische Beziehung führen zu wollen. Dabei schließe das eine das andere jedoch nicht automatisch ein: Ein Menschen könne sowohl Ace als auch Aro sein, jedoch auch nur aromantisch und trotzdem mit dem Verlangen nach Sex, oder asexuell und trotzdem mit dem Wunsch nach einer romantischen Beziehung. Caro bezeichnet sich als Ace/Aro und hat nur selten und unter bestimmten Umständen Lust auf Knutschen oder Sex, wie man es von klassischen romantischen Beziehungen erwarten würde. Sie fühle sich einfach nicht romantisch zu Menschen hingezogen – sondern platonisch. Im Ace/Aro-Spektrum gibt es für diese Art von Anziehung einen Begriff, der den romantischen „Crush“ (Schwarm) ersetzt: Man spricht davon einen „Squish“ zu haben. „Ein Squish ist ein super intensives Gefühl einer anderen Person gegenüber, das aber nicht von romantischer Natur ist.“ Das könne sich sogar ähnlich äußern wie verknallt sein, dass man einer Person sehr nah sein und viel Zeit mit ihr verbringen will – aber eben freundschaftlich. Als „mehr als eine normale Freundschaft, weniger als eine romantische Beziehung“ und „irgendwas zwischen Partner*In und Freund*In“ beschreibt Caro die queer-platonischen Beziehungen, die aus solchen Squishes entstehen können. Der Unterschied zu „normalen“ Freundschaften sei dabei, dass es in queer-platonischen Beziehungen schon eine „wesentlich tiefere emotionale Bindung“ gäbe. Dabei werde vorher „klipp und klar“ kommuniziert, was jeder will. Es gibt sogar einen queer-platonischen Beziehungsvertrag, bei dem man umkreisen und durchstreichen kann was man mag, und was nicht, wie „kleine Küsse“, „große Küsse“, „Sex“ und „Händchen halten“. Caro findet, dass solche Absprachen in jeder Art von Beziehung gelten sollten – auch klassischen, hetero-romantischen – da es ein „vorgefertigtes Bild gibt von dem, was in einer romantischen Beziehung passieren soll oder darf, oder nicht, und darüber redet niemand, aber alle wissen es, und es ist irgendwie allgemeingültiges Gesetz – obwohl das eigentlich eine Sache ist, die total individuell ist. Jeder Mensch ist ja anders und jeder Mensch kann Nähe anders zulassen, an sich ranlassen, und zurückgeben“.