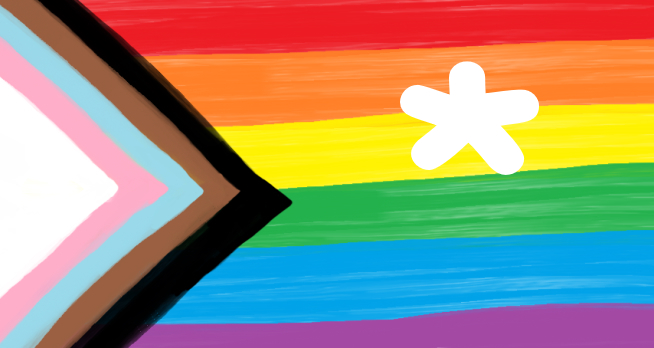Queere Vielfalt in Schulen: Vom Anspruch zur gelebten Praxis
26. Februar 2026Weiterlesen Queere Schüler*innen erleben nach wie vor überdurchschnittlich häufig Diskriminierung, Ausgrenzung oder Mobbing. Studien (z.B. der European Union Agency for Fundamental Rights, 2024) zeigen, dass fehlende Sichtbarkeit und mangelnde Sensibilität im schulischen Umfeld negative Auswirkungen auf psychische Gesundheit, Lernmotivation und Bildungsbiografien haben können. Eine inklusive Schulkultur ist deshalb keine Zusatzaufgabe, sondern Teil professioneller Schulentwicklung. Vor diesem Hintergrund hat die SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag einen Antrag in den Landtag eingebracht, der sich mit der Stärkung queerer Vielfalt und dem Schutz vor Diskriminierung im schulischen Kontext befasst. Im Kern geht es darum, bestehende Maßnahmen weiterzuentwickeln, Sensibilität strukturell zu verankern und Schulen in ihrer Verantwortung für ein diskriminierungsfreies Lernumfeld zu unterstützen. Der Antrag ist damit Ausdruck einer breiteren gesellschaftlichen Debatte – im Mittelpunkt steht jedoch das Thema selbst: Wie gelingt es, Vielfalt verbindlich in schulische Praxis zu übersetzen? Es gibt bereits bewährte Ansätze, auf die sich zurückgreifen lässt: 1. Verlässliche Ansprechpersonen und Schutzkonzepte: Schulen können feste Vertrauenslehrkräfte oder Diversity-Beauftragte benennen, die für Fragen rund um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität qualifiziert sind. Ergänzend wirken klar formulierte Antidiskriminierungsleitlinien, die explizit LSBTIQ*-Feindlichkeit benennen. Solche Schutzkonzepte orientieren sich häufig an Empfehlungen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die betont, dass Diskriminierungsschutz institutionell verankert sein muss – nicht nur situativ reagierend. 2. Selbstgewählter Name und Pronomen im Schulalltag: Ein niedrigschwelliger, aber wirkungsvoller Schritt ist die konsequente Nutzung des selbstgewählten Namens und der gewünschten Pronomen. Auch wenn Personenstandsänderungen noch nicht abgeschlossen sind, signalisiert diese Praxis Anerkennung. Schulinterne Handreichungen können Lehrkräften Sicherheit im Umgang mit datenschutzrechtlichen Fragen geben und Missverständnisse vermeiden. 3. Unterrichtliche Verankerung: Queere Lebensrealitäten lassen sich in verschiedenen Fächern thematisieren: Im Deutschunterricht über Literatur, im Geschichtsunterricht über Emanzipationsbewegungen, im Biologieunterricht differenziert und wissenschaftlich fundiert. Wichtig ist dabei eine sachliche, altersangemessene und stereotypfreie Darstellung. Das Deutsches Jugendinstitut weist darauf hin, dass Sichtbarkeit im Lehrplan signifikant zur Reduktion von Vorurteilen beitragen kann. 4. Kooperation mit externen Trägern: Workshops mit queeren Bildungsinitiativen oder Projekttage zu Vielfalt und Demokratiebildung schaffen Raum für Fragen, die im regulären Unterricht oft zu kurz kommen. Hier profitieren Schulen von Kooperationen mit regionalen Netzwerken und Landesprogrammen. In Schleswig-Holstein unterstützt das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Programme zur Stärkung von Akzeptanz und Diversität im Bildungsbereich, z.B. SCHLAU Schleswig-Holstein, ein landesweite Netzwerk lokaler SCHLAU Gruppen mit einem breiten Angebot an Bildungs-, Aufklärungs- und Antidiskriminierungsworkshops zu geschlechtlicher, sexueller und romantischer Vielfalt für Schulen, Sportvereine, Jugendzentren und andere Jugendeinrichtungen. Queere Vielfalt in Schulen ist kein Randthema und keine ideologische Zusatzdebatte. Es geht um Bildungsqualität, Chancengerechtigkeit und den Schutz junger Menschen. Politische Initiativen wie der Antrag der SPD-Fraktion machen deutlich, dass dieses Thema auch auf Landesebene als strukturrelevant verstanden wird – entscheidend bleibt jedoch die konkrete Umsetzung im schulischen Alltag.