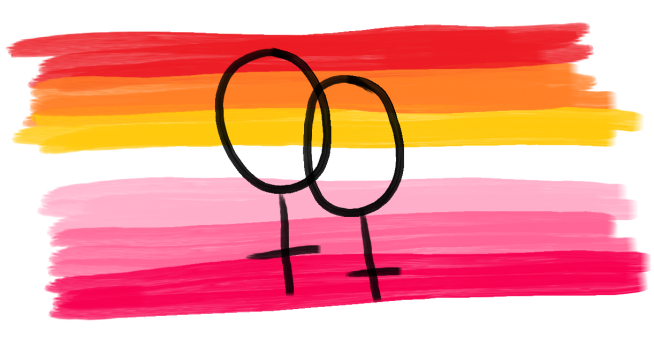Ebow – „Lesbisch“, „K4L“ (Kanake 4 Life) und „Free.“
20. November 2025Weiterlesen Die Rapperin, Künstlerin und Schauspielerin Ebow, bürgerlich Ebru Düzgün, wurde 1990 in München geboren und wuchs im Münchner Westend auf. Sie ist Teil einer kurdischen Familie. Ihre Großmutter kam als Gastarbeiterin nach Deutschland und die Mutter trennte sich vom Vater, um ihrer Tochter eine Ausbildung zu ermöglichen. Ebow selbst studierte bis zum abgeschlossenen Master Architektur, bevor sie sich ganz der Musik widmete (Münchner Feuilleton, Goethe-Institut). Schon früh machte Ebow auf Münchens Bühnen auf sich aufmerksam, etwa beim on3-Festival des Bayerischen Rundfunks (2011) oder dem Sound-of-Munich-Now-Festival (2012). Ihr Sound ist geprägt von einer Mischung aus orientalischen Klängen, R’n’B und Hip-Hop, in dem sich sowohl ihre kulturellen Wurzeln als auch ihre Vielseitigkeit als Künstlerin widerspiegeln (Münchner Feuilleton). Seit ihrem ersten Album „Ebow“ aus dem Jahr 2013 sind vier weitere Studioalben entstanden: Komplexität (2017), K4L – Kanake for Life (2019), Canê (2022) und FC Chaya (2024). Sie beschreibt sich selbst als politische Musikerin, die sich in ihren Texten und Sounds mit dem Leben als Deutsche mit Migrationshintergrund, Queerfeminismus, Kapitalismuskritik und mit dem Aufwachsen als kurdische lesbische Frau in einer patriarchalen Gesellschaft beschäftigt (ebd., Amnesty International). Ebow eignet sich dabei Machtsymbole der männlich dominierten Deutschrap-Szene an, um auf die Machtdiskrepanzen zwischen Geschlechterrollen und Klassen in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und sich als Frau zu emanzipieren. Ihr Ziel: den Deutschrap von sexistischen und homophoben Klischees befreien und ihm eine feminine, queere und experimentelle Mentalität verleihen (Goethe-Institut). Sie sieht dabei jedoch die Gefahr, in sozialen, teils akademischen Blasen zu versickern: „Wenn wir gemeinsam kämpfen wollen, etwa gegen Rassismus und Sexismus, wieso gibt es dann so viel Beef in den eigenen Reihen? Ich hatte das Gefühl, manchen Leuten ging es nicht darum, eine Gemeinschaft voranzubringen, sondern sich selbst zu vermarkten.“ (ebd.) Ebow ist also eine Musikerin mit intersektionaler Perspektive. Ihr ist besonders wichtig, nicht primär Songs für weiße Menschen zu schreiben, die sich mit intersektionalem Feminismus auseinandersetzen, sondern ihre Energie in ihre eigene Community zu stecken. Im Song „Hengameh“ findet sich diese Haltung wieder (ebd.). Mit ihrem jüngsten Album „FC Chaya“ (2024) zeigt sich Ebow so persönlich und verletzlich wie bisher noch nie. Besonders eindrücklich ist der Song „Ebrus Story“, in dem sie von ihrem jahrelang aufgeschobenen Coming-Out als lesbische Frau erzählt. „Den Song zu schreiben und zu veröffentlichen hat sich extrem befreiend angefühlt“, sagt sie. Mit ihrer Tante hatte sie zuvor gesprochen, doch für den Rest der Familie kam ihr Outing durch den Song. Ihre Mutter erwiderte wertschätzend: „Man lerne sich ein Leben lang neu kennen.“ (Amnesty International) Ebow ist eine Stimme des deutschen Queerfeminismus und einer migrantischen Gesellschaft. Durch poetische Wut, Aneignung von Symbolen zu Selbstermächtigung und Solidarität zur Vielfalt. Dieser Artikel ist nur ein kurzes Portrait über die Rapperin „Ebow“, um sie kennenzulernen und einen Einstieg in die Musik zu finden. Der Titel des Artikels zeigt wichtige Songs und einen Einblick in Ebows Laufbahn und Schaffen, in die unbedingt reingehört werden sollte! Foto: Cover Foto by Nikolas Petros Androbik, 2024.