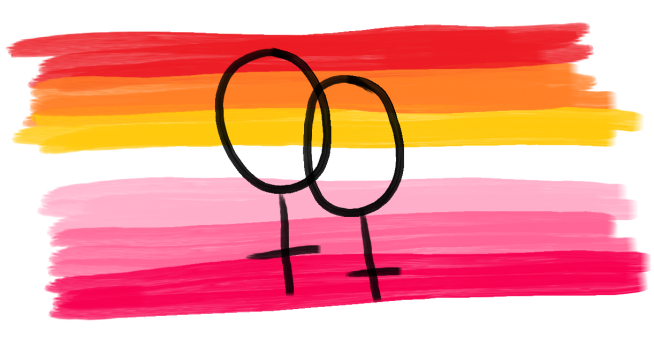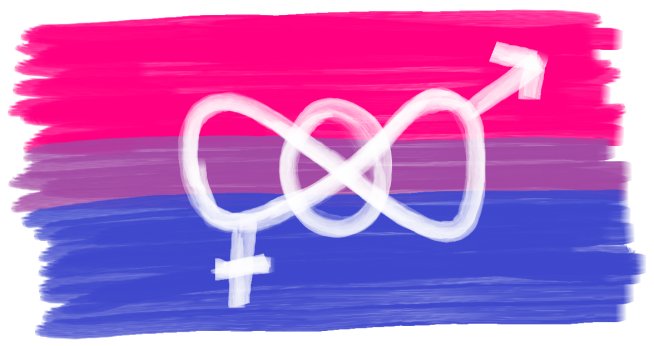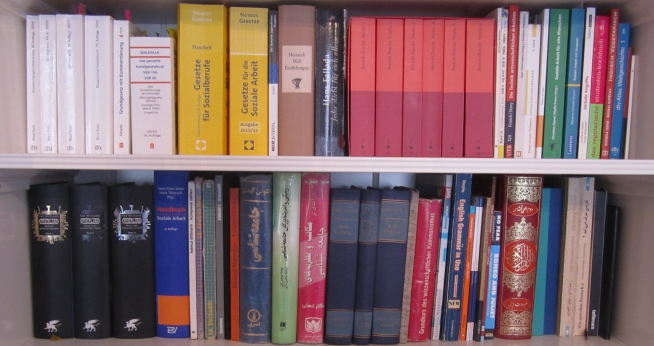Unterstützung
Gemeinschaftliches und solidarisches Wohnen für lesbische Frauen im Herzen der Hauptstadt
10. November 2020Generationenübergreifendes gemeinschaftliches Wohnen und Leben für Lesben und Frauen mit und ohne Behinderung – das ist das Ziel der Initiative RuT-FrauenKultur&Wohnen.
In Berlin soll dafür bis 2022 ein inklusives Wohnprojekt, an welches ein Zentrum mit Kultur- und Beratungsangeboten angeschlossen ist, entstehen. Das Konzept beinhaltet 70 Wohnungen, Gemeinschaftsräume sowie eine Pflege-WG mit acht Plätzen für pflegebedürftige Frauen.
Konzipiert und betrieben wird das Projekt vom Berliner Verein „RuT–Rad und Tat – Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V.“, welcher 1989 in eigener Initiative von einer Gruppe älterer und behinderter lesbischer Frauen gegründet wurde. Hintergrundidee für das entstehende Wohnprojekt sind die besonderen Bedürfnisse älterer oder behinderte lesbischer Frauen. Sie sind von Mehrfachdiskriminierung betroffen und als Gruppe gesellschaftlich oft unsichtbar sowie werden politisch wenig berücksichtigt. Das Projekt soll ihnen ein selbstbestimmtes Leben und soziale Teilhabe sowie bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Damit ist es bundesweit einmalig und schließt eine Lücke in der Versorgung für diese Zielgruppe.
In einem zentral in Berlin-Mitte gelegenen Neubaukomplex sind die Wohnungen geplant, die altersgerecht und barrierefrei sein werden. Gesundheitspräventionsprojekte und Kultur- und Freizeitveranstaltungen runden das Angebot ab. Den Bewohner*innen sollen Sportkurse wie z.B. Yoga oder Gymnastik zur Verfügung stehen und ein Programm aus u.a. Lesungen, Spielenachmittagen oder Ausflügen ermöglicht werden. Eine solche Form des gemeinschaftlichen Wohnens, wie sie von RuT-FrauenKultur&Wohnen geplant ist, ist damit auch eine Alternative für Frauen, die nicht alleine oder im Seniorenheim leben möchten.
RuT-FrauenKultur&Wohnen will zudem am Ort des Wohnprojektes ein Kompetenzzentrum rund um die Themen Lesben und Alter sowie Lesben und Behinderung einrichten. Hier sollen Bildungsverstanstaltungen und Tagungen stattfinden, und auch der Dachverband Lesben und Alter wird mit seiner Geschäftsstelle im Projekt lokalisiert sein.
„Schwestern können sich gegenseitig helfen. Schwestern können voneinander lernen. Schwestern sind sich ähnlich und sie sind zugleich ganz unterschiedlich.“ So beschreiben die refugee sisters ihr Ziel, Frauen* mit Fluchterfahrungen einen vertraulichen Raum zu bieten, in dem sie sich mit ihren Erlebnissen, Wünschen, Fragen und Sorgen öffnen können.
Es gibt unter anderem praktische Unterstützung, beispielsweise im Umgang mit Ämtern, Treffen zu verschiedenen Themen, Einzelgespräche und Begleitung. Auf der Internetseite informiert das Projekt über Asylverfahren, LGBTI Rechte in Deutschland und Europa oder auch LGBT & Religion.
Zugleich sucht das Projekt Unterstützerinnen: neben finanzieller Unterstützung zum Beispiel auch Deutsch-Nachhilfe, Kinderbetreuung, ein Zimmer oder Gegenstände für den Alltagsgebrauch.
Refugee sisters ist ein Projekt von Intervention e.V. und wird gefördert durch den Integrationsfonds der Stadt Hamburg.
Weitere Infos finden sich hier.
„Nicht mit mir!“, „Fass mich nicht an!“ und „Das lass ich mir nicht gefallen!“ – so lauten die Aussprüche auf den Bannern der offiziellen Webseite der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig Holstein, welches den Aktionsplan echte-vielfalt für die Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten in Schleswig-Holstein unterstützt.
Damit ruft die Polizei zur Anzeige „homo- und transphober Straftaten“ auf, um die hohe Dunkelziffer verbaler und körperlicher Gewalttaten auf LSBTIQ*-Personen zu erhellen: „ganz einfach auf jeder Polizeidienststelle oder bei der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ*“, oder „ganz einfach online“, und „ganz einfach, weil es dein Recht ist“.
Dass es für LSBTIQ*-Personen „ganz einfach“ wäre Beleidigungen und körperliche Übergriffe aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung anzuzeigen, sei jedoch dahingestellt. Und darüber hinaus, ob das „speziell geschulte Personal“ bei der Landespolizei, welches für alle Fragen im Zusammenhang mit solchen Straftaten zur Verfügung stehe, tatsächlich die geeignetsten Ansprechpersonen für Opfer homo- oder transphober Gewalt sind. Denn „mit zwei Cis-Männern wirbt die Landespolizei seit 1. September um mehr Vertrauen in der queeren Community“, wie Queer.de nach der Bekanntgabe des zunächst einjährigen Pilotprojektes 2018 schrieb. Ein Beitrag zu „Konzeptionen (queer) feministischer Schutzräume“ in der Zeitschrift „Femina Politica“ für Perspektiven queerfeministischer politischer Theorie argumentiert, dass (queer) feministische Schutzräume unter anderem das gemeinsame Ziel hätten, „ihren Nutzer_innen Schutz zu bieten vor unterschiedlichen Formen von Gewalt und Unterdrückung, die diese in der patriarchalen Gesellschaft erfahren: Schutz vor sexuellen Übergriffen, vor Dominanz, der Reduktion auf weibliche Rollen, vor Sexismus; in manchen Räumen auch Schutz vor Triggern im Zusammenhang mit Männlichkeit, vor Homophobie und Transphobie“.
So wäre es eventuell – ohne die Kompetenzen, Schulungen und Intentionen der beiden Polizisten oder gar die Sinnhaftigkeit des Projektes infrage zu stellen – eine Überlegung wert, gerade online auch für die Repräsentation von Frauen und trans Personen zu sorgen. Diese Frage formulierte im September 2018 auch schon die taz in einem Interview mit Jens Puschmann, dem Initiator der Ansprechstelle: „Sie und Ihr Kollege sind Männer, wäre es nicht gerade hier besser Bezugspersonen beider Geschlechter in der Beratungsstelle zu haben?“. Puschmann antwortete darauf, dass eine paritätische Besetzung zwar das Ziel sei und vorgesehen war, sich aber keine Kollegin gefunden habe, um das Projekt mit ihm zu anzufangen, weswegen sie „mit zwei Männern starten“.
Fast zwei Jahre später gibt es dennoch keine Veränderung in der Besetzung – was auch ein positives Zeichen für das gute Funktionieren des Projektes sein könnte. Eine solche Ansprechstelle ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um das Schweigen um Hasskriminalität gegen LSBTIQ*-Personen zu brechen. Genauso wichtig ist es, dort nicht stehenzubleiben, sondern ständig – auch innerhalb der Strukturen und Institutionen – für mehr Repräsentation und Inklusion zu arbeiten.
Der Psychosoziale Trägerverein Eppendorf Eimsbüttel (PST e.V.) bietet in Hamburg in Kooperation mit dem Magnus-Hirschfeld-Centrum Hamurg (MHC) das „Andersrum Projekt“ an, Wohngemeinschaften für psychisch erkrankte Menschen aus dem LSBTIQ*-Kontext. Zunächst 2016 als Projekt für schwule Männer mit psychischen Erkrankungen gegründet, wurden die WGs 2018 für weitere Personengruppen geöffnet.
Die Mitarbeiter*innen des PST bieten Unterstützung und Hilfe bei psychischen Erkrankungen und Krisen an. Dies zum Beispiel für Menschen, die aus einem stationären Aufenthalt entlassen werden, und Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu organisieren.
Gerade queere psychisch erkrankte Menschen leiden oft unter einer doppelten Stigmatisierung, und profitieren von einer auf sie zugeschnittenen sozialpädagogischen Betreuung.
Die Bewerber*nnen für die WGs werden vom PST-Team unter Unterstützung des Fachamts für Eingliederungshilfe ausgewählt, die Art der psychischen Erkrankung ist dabei nicht relevant. Derzeit verfügt das Angebot über 10 Wohnplätze in drei Wohngemeinschaften und einer Einzelwohnung in Hamburg Altona Nord.
HAKI e.V. ist ein in Kiel und in Schleswig-Holstein aktiver Verein, der sich den Themen geschlechtliche Vielfalt, gleichgeschlechtliche Lebensformen sowie der Vielfalt sexueller Orientierungen widmet. Das HAKI-Zentrum in Kiel ist Anlaufstelle und Treffpunkt für alle Menschen aus dem LSBTIQ*-Spektrum in Schleswig-Holstein.
Schwerpunkte der Arbeit sind Aufklärungs- und Bildungsangebote zum Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung und die Stärkung der Selbstbestimmung von LSBTIQ* und Unterstützung bei Problemen durch Beratungs- und Jugendarbeit. Auch Selbsthilfe- und Freizeitangebote gehören zum Engagement von HAKI e.V.
Verschiedene (Arbeits-)Gruppen beschäftigen sich mit spezifischen Themen oder sprechen bestimmte Zielgruppen an. So zum Beispiel queere Migrant*innen und Geflüchtete oder LSBTIQ* mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen.
Mein Kind ist intergeschlechtlich – und nun?
29. September 2020Intergeschlechtliche oder intersexuelle Menschen haben angeborene, körperliche Geschlechtsmerkmale, die sich nicht nur als eindeutig männlich oder weiblich einordnen lassen. Medizinisch werden diese als Varianten der Geschlechtsentwicklung gefasst und darunter unterschiedliche biologische Phänomene verstanden. Diese können Variationen in den Geschlechtsmerkmalen wie z.B. den Geschlechtsorganen oder Geschlechtschromosomen beinhalten.
Nicht nur von Inter*-Organisationen wird kritisiert, dass intergeschlechtliche Menschen als Säuglinge oder Kinder operiert oder medizinisch behandelt werden, um bei ihnen eine geschlechtliche Eindeutigkeit herzustellen. Diese nicht rückgängig zu machenden Eingriffe erfolgen oft ohne medizinische Notwendigkeit und informierte Einwilligung der Betroffenen.
Auf regenbogenportal.de beschreibt die Mutter eines intersexuellen Kindes, Maria Blume, was Eltern tun können, deren neugeborenes Baby nicht als Junge oder Mädchen auf die Welt kommt. Eine solche Erfahrung wirft nämlich viele Fragen auf und kann Eltern verunsichern.
Ein Wichter Aspekt neben der Liebe und Wertschätzung für das Baby ist, sich Zeit zu lassen, und der neuen und ungewohnten Situation Raum zu geben.
Durch die Reform des Personenstandsrechts können Kinder, deren Geschlecht bei der Geburt nicht eindeutig feststellbar ist, zunächst ohne Geschlechtsangabe oder mit dem Eintrag „divers“ ins Geburtenregister eingetragen werden. Geschlechtsneutrale Namen bieten sich an, um allen Beteiligten den Alltag zu erleichtern.
Empfohlen wird, bei der Suche nach medizinischer Versorgung auf Kliniken oder Ärzt*innen zu achten, welche auf der Grundlage der geltenden Leitlinien behandeln und nur Untersuchungen und Behandlungen durchführen, die momentan medizinisch notwendig sind. Das gilt besonders für chirurgische Eingriffe in denen Genitalien operativ angeglichen werden sollen. Diese sollten erst vorgenommen werden, wenn ein Kind später die Folgen abschätzen und selbst darüber entscheiden kann. Auch Familienangehörige können darüber informiert werden, dass das Kind später selbst entscheiden soll, welchem Geschlecht es sich zugehörig fühlt.
Freund*innen und Bekannten können kurze Informationen darüber gegeben werden, dass beim neugeborenen Kind eine Variation der Geschlechtsentwicklung vorliegt und dazu noch Untersuchungen gemacht werden, dies sollte zunächst ausreichen. Inwieweit dabei ausführlicher über medizinische Details berichtet werden sollte, bleibt den Eltern überlassen.
Für die Erziehung des Kindes ist die Vermittlung von Geborgenheit und Sicherheit zentral. Sobald das Kind größer ist, sollte es in der Findung einer eigenen geschlechtlichen Identität unterstützt werden und darüber selbst entscheiden.
Verschiedene Spielzeuge sollten angeboten werden, und das Kind sollte selbst herausfinden, womit es spielen möchte.
Sobald das Kind in ein Alter kommt, in dem Unterschiede zwischen den Geschlechtern wahrgenommen und angesprochen werden, können die Eltern mit dem Kind darüber sprechen. Dabei ist es wichtig, dass dem Kind vermittelt wird, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine Besonderheit kein Makel darstellt.
Beratung und Hilfestellung finden Eltern intersexueller Kinder auch hier.
Bi-Stammtische im Norden
8. September 2020Gleichgesinnte treffen, sich austauschen oder einfach einen netten Abend in Gemeinschaft verbringen – diese Möglichkeit bieten Stammtische für bisexuelle Menschen an.
Auch wenn diese während der Corona-Pandemie zeitweise nur online stattfinden konnten: Gerade diejenigen, die neu in der queeren Community oder noch unsicher darüber sind, ob sie eigentlich bisexuell sind, können bei solchen regelmäßig stattfindenden Treffen ungezwungen und niedrigschwellig Kontakte knüpfen oder Informationen erhalten.
Bi-Stammtische gibt es im Norden zum Beispiel in Kiel und Hamburg.
Wie kann eine LSBTIQ* wertschätzende beraterische oder therapeutische Begleitung gestaltet werden? Dieser und weiteren Fragen widmet sich die ab Herbst 2020 zum zweiten Mal stattfindende berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung LSBTIQ*-Beratung (CAS).
Der Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie (VLSP*) bietet diese in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe an. Der VLSP* ist ein Zusammenschluss von in psychologischen Berufsfeldern tätigen Menschen, die sich mit den Themen sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt auseinandersetzen wollen.
Wie Dr. Gisela Wolf, Psychotherapeutin und Vorstandsmitglied von VLSP* in einem Fachartikel erläutert, gehören lesbische, schwule und bisexuelle KlientInnen zu den Personengruppen, die relativ häufig psychotherapeutischen Versorgung in Anspruch nehmen. Dennoch würde sexuelle Orientierung in den psychotherapeutischen Ausbildungen kaum thematisiert, und damit nicht auf die psychotherapeutischen Bedarfe von queeren Klient*innen und die dafür notwendige Fachkompentenz vorbereitet.
Diese bisherige Leerstelle in der Qualifikation von psychotherapeutisch arbeitenden Personen wird mit der Weiterbildung "LSBTIQ*-Beratung (CAS)“ nun entsprechend gefüllt. Das Weiterbildungsangebot richtet sich dabei nicht nur an Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen, sondern auch Berufsfelder wie die soziale Arbeit sind hiervon adressiert. Kenntnisse rund um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt in Psychotherapie und Beratung werden im Rahmen der Fortbildung vermittelt. Neben Grundlagenwissen zu LSBTIQ* wird zum Beispiel Wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen oder die Vielfalt von Beratungsanliegen in diesem Kontext erlernt. Neben Anregung zur Selbstreflexion sollen die Beratenden für eine LSBTIQ*-sensible Umsetzung von Beratungs- und Therapiemethoden qualifiziert werden.
Die Weiterbildung wird in Form von Seminaren absolviert, die sowohl als Präsenzlehre wie auch in Fernlehre durchgeführt werden. Nach einer Abschlussprüfung wird das CAS-Zertifikat (Certificate of Advanced Studies) erworben.
Queer Altern in Zürich und Berlin
22. Juli 2020Am 15.01.2020 berichtete die Neue Zürcher Zeitung, dass der Zürcher Gemeinderat mehr Sensibilität für LGBT-Menschen in Altersheimen gefordert habe – gleich drei Vorstöße zum Thema LGBT und Pflege seien behandelt worden. Zum Thema queer Altern arbeitet der gleichnamige Zürcher Verein jedoch bereits seit Jahren, die Vision sei es in Zürich ein Wohnangebot für „Queers & Friends“ zu schaffen.
„Konkret planen wir, dass nicht bloss ältere queere Menschen dort wohnen, sondern es in gewissem Umfang auch Platz für jüngere LGBTQs gibt. Wir wollen eine «caring community» schaffen, in der wir aufeinander Acht geben, so wie wir es schon einmal zeigten während der Aids-Krise in den 1980er und 90er Jahren“, so der Vereinspräsident Vincenzo Paolino in einem Interview mit dem Stadtmagazin hellozurich. Queers bräuchten ein spezielles Altersangebot, weil seiner Meinung nach Alters- und Pflegeeinrichtungen in der Schweiz nicht LSBTIQ*-freundlich seien – queere Senior*innen und müssten ihr Outing so täglich aufs Neue durchmachen und sich ständig neu erklären. Dabei seien auch Mitarbeitende nicht entsprechend sensibilisiert. In London gäbe es schon ein Angebot zur Schulung und Zertifizierung von stationären Einrichtungen zu LSBTIQ*-Themen – Paolino fände dies auch für die Schweiz sehr gut. „Ich bin sicher, dass unser Haus eine Leuchtkraft für die Schweiz entwickeln wird, indem Wissen und Erfahrung entstehen, die weitergegeben werden können.“
Diese Leuchtkraft könnte es sogar bis Deutschland reichen – denn in Deutschland gibt es rund 17,5 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Angenommen davon sind – nach was Paolino für die Schweiz als „konservative“ Rechnung bezeichnet – nur 5% queer, so gibt es in Deutschland mehr als 850 Tausend Senior*innen, die von einem queeren Wohnangebot im Alter profitieren könnten. Zwar gibt es auch hierzulande Pionier-Projekte, wie den Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin in Charlottenburg. Doch während ein solch unabhängiges Wohnangebot für fitte Senior*innen genau das richtige sein kann, gibt es wohl auch viele Ältere, für die eine solche Option nicht in Frage käme. Gerade Menschen mit Erkrankungen wie Demenz brauchen ein wohlwollendes und sicheres Umfeld – und für queere Senior*innen gilt dies selbstverständlich auch in Hinblick auf das offene Leben ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität.