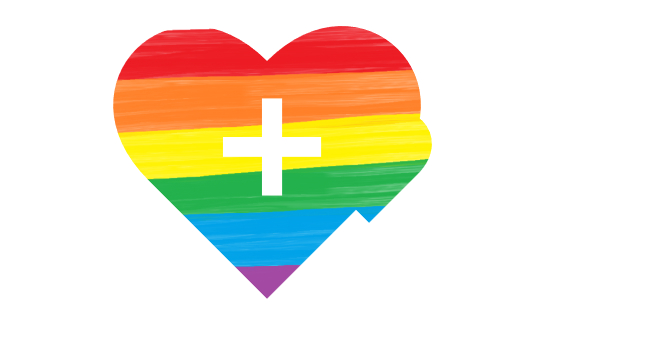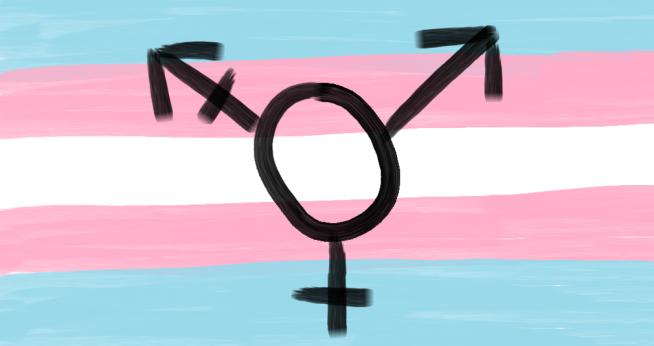Weiterlesen Wie eine Studie der Charité vor Kurzem ermittelte, sind LSBTIQ stärker von den Veränderungen und Einschränkungen durch Corona betroffen. Die gerade erschienene Broschüre der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, des Bundesverband Trans*, des Vereins Intergeschlechtliche Menschen e.V. und des Lesben- und Schwulenverbandes mit dem Titel „Auswirkungen der Coronapandemie auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche, queere und asexuelle Personen in Deutschland“ widmet sich ebenfalls diesem Thema. Die vom Bundesfamilienministerium mitfinanzierte 40-seitige Broschüre enthält Informationen, die auf Fachgesprächen mit Expert*innen sowie einer Befragung von LSBTIQ-Organisationen und Initiativen basieren. Dabei wurden vier Themenbereiche identifiziert: Communitystrukturen, Gesundheit, Lockdown und Kontaktbeschränkungen sowie gesellschaftliche Debatten und Agenda Setting. Mit der Broschüre sollen unter anderem Entscheidungsträger*innen in Politik und motiviert werden, die Auswirkungen der Pandemie auf unterschiedliche Gruppen in den Blick zu nehmen. Es gelte, so die Herausgeber*innen, mit LSBTIQ-Communityvertreter*innen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen kurz- und langfristige Lösungsansätze zu erarbeiten. Im Folgenden sollen zentrale Ergebnisse der Broschüre kurz dargestellt werden: Wie die Broschüre im Abschnitt „Communitystrukturen“ herausstellt, sind durch die Coronapandemie Schutzräume und Anlaufstellen für LSBTIQ geschlossen. Beratungs- und Selbsthilfeangebote sind nur eingeschränkt verfügbar, und viele Organisationen fürchteten, dass ihre finanzielle Förderung gekürzt werde. Die Gesundheitssituation queerer Menschen hat sich durch die Pandemie verschärft. Insbesondere trans und intergeschlechtliche Menschen werden in der Gesundheitsversorgung nach wie vor stigmatisiert. Lockdown und Kontaktbeschränkungen: LSBTIQ-Personen mussten den Lockdown mitunter mit Familienmitgliedern verbringen, von denen sie abgelehnt oder diskriminiert werden. Durch das Verbot von Sexarbeit waren insbesondere auch queere Sexarbeiter*innen betroffen, die durch das staatliche Hilfesystem fielen. In Einrichtungen für geflüchtete und wohnungslose Personen ist ein Rückzug ins Private kaum möglich. Gerade in solchen Räumen erfahren queere Menschen häufig Gewalt und Diskriminierung. Ausnahmen für die strengen Kontaktbeschränkungen werden hauptsächlich für Familien und Paarbeziehungen gemacht, wird in der Broschüre im Abschnitt Debatten und Agenda Setting festgestellt wird. Menschen in anderen Lebens- und Familienformen jenseits der heterosexuellen Kleinfamilie werden benachteiligt und geraten aus dem Blick. Zudem verfestigen sich traditionelle Geschlechterverhältnisse. Die gesellschaftliche Verunsicherung werde zudem von rechten Bewegungen genutzt, um gegen Diversität Stimmung zu machen und Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Unterstützung
Weiterlesen Die Stiftung setzt sich weltweit für Menschenrechte von LSBTIQ ein und unterstützt Partnerorganisationen im globalen Süden und in Osteuropa. Durch Aufklärung- und Überzeugungsarbeit bei politisch Verantwortlichen sowie Kampagnen gegen Homophobie und strafrechtliche Verfolgung soll die Menschenrechtssituation von LSBTIQ verbessert werden. „In 76 Staaten wird Homosexualität heute noch strafrechtlich verfolgt, in einigen Ländern der islamischen Welt sogar mit Todesstrafe bedroht. Vielerorts sind staatliche Behörden an der Unterdrückung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender beteiligt, verweigern ihnen jeglichen Schutz vor Anfeindungen und Gewalt“ so schreibt die Stiftung über ihr Problemfeld. Auch in Europa schlage Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender mitunter noch Hass entgegen und werden ihre Grundrechte eingeschränkt. Grundlage der Arbeit sind die Yogykarta-Prinzipien, eine Zusammenstellung von Menschenrechtsstandards in Bezug auf sexuelle Minderheiten und LSBTIQ, die von führenden Menschenrechtsexpert*innen entwickelt wurde. Zu den Strategien der Stiftung zählt die direkte Hilfe für LSBTIQ-Organisationen und Projekten im Ausland, die Organisation von Menschenrechtskongressen und Tagungen, internationale Lobbyarbeit, Informationsvermittlung und Forschung. Die Arbeitsschwerpunkte liegen bisher in Afrika, Mittelamerika und Osteuropa. Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung gibt außerdem eine Schriftenreihe heraus. Zu den erschienenen Bänden gehört unter anderem eine deutschsprachige Übersetzung der Yogykarta-Prinzipien.
Studie: LSBTI überdurchschnittlich stark durch Einsamkeit während der Corona-Krise belastet
29. März 2021Weiterlesen Die Forscher*innen um Wolfram Hermann führten die Befragung mittels eines Online-Fragebogens durch. Im März/April 2020 gab es eine erste Erhebungswelle, im Januar/Februar 2021 fand zweite Befragung statt. Ziel der Studie des Instituts für Allgemeinmedizin war es, die Situation und das Befinden von Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie zu untersuchen. Dabei lag ein Schwerpunkt der Studie auf LSBTI-Menschen. „Es zeigt sich, dass Teilnehmer*innen, ohne Partner, ohne Kind, alleine wohnend, unter 65 und LGBTIA+ einsamer waren“ schreiben die Autor*innen der Studie über die bisherigen Ergebnisse. Auch zeigte sich eine höhere Einsamkeit in der zweiten Befragungswelle im Vergleich zur ersten Befragungswelle. In der Gruppe der LGBTIA+ Menschen seien vor allem asexuelle Menschen, trans Menschen und non-binäre Menschen besonders ausgeprägt von Einsamkeit betroffen, auch wenn diese in einer Partnerschaft seien. Die Pandemie belaste insbesondere Menschen, die vorher schon von psychischen Problemen betroffen waren. So gaben Befragte, die sich während der Befragung in Psychotherapie befanden, an, dass die Psychotherapie während der Pandemie seltener stattfand oder langfristig ausfiel. Insgesamt, so die Forscher*innen, zeige sich weiterhin ein hoher psychosozialer Unterstützungsbedarf. Insbesondere asexuellen, trans und non-binäre Menschen sollten digitale Unterstützungs- und Vernetzungsangebote als Mittel gegen Einsamkeit angeboten werden. Hausärzt*innen sollten bei Patient*innen, die sich zurzeit in Psychotherapie befinden, gezielt nachfragen, ob diese aktuell ausreichend stattfindet. Es sei außerdem empfehlenswert, wenn Hausärzt*innen bei LGBTIA+ Patient*innen gezielt nach Einsamkeit fragen.
Weiterlesen Noch immer ist es im Profifußball der Männer ein Tabu, sich als schwul zu outen. Zurzeit gibt keinen einzige offen homosexuellen Fußballer im Profifußball der Männer. Deswegen haben Fußballer*innen aus ganz Deutschland nun eine Aktion ins Leben gerufen: Unter dem Hashtag #ihrkönntaufunszählen und einer Erklärung, die im Fußballmagazin 11 Freunde veröffentlicht wurde, sicherten sie homosexuellen Spieler*innen ihre Unterstützung zu. „Wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen. Denn ihr tut das Richtige, und wir sind auf eurer Seite", heißt es in dem Solidaritätsschreiben. Zu den Unterzeichner*innen des Aufrufes gehören unter anderen Profis wie Max Kruse (1. FC Union Berlin), Niklas Stark (Hertha BSC), Bakery Jatta (Hamburger SV), die Nationalspielerinnen Almuth Schult und Alexandra Popp (VfL Wolfsburg). Auch ganze Mannschaften wie zum Beispiel der 1. FC Köln haben den Appell unterschrieben. Niemand solle zu einem Coming-out gedrängt werden, betonen die Unterzeichner*innen. Dies sei die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Denjenigen, die sich dafür entscheiden würden, wollen die Unterzeichner*innen ihre Solidarität zusichern. Es gehöre zu den elementaren Freiheitsrechten jedes Menschen gehört, sich zu seiner sexuellen Orientierung bekennen zu können. In den sozialen Medien wie Twitter wurde die Kampagne begeistert aufgenommen und verbreitet. Der DFB findet die Initiative eine „starke und wichtige Aktion“. Eine Userin kommentiert den Aufruf mit „Ob auf dem Platz, in der Fankurve oder in der Gesellschaft: was zählt ist Respekt, Akzeptanz & Vielfalt. Danke für diese wichtige Aktion @11Freunde_de die zeigt, wir dürfen nicht aufhören gegen Diskriminierung zu kämpfen und seid euch sicher #ihrkönntaufunszählen“.
Was ist eigentlich ein „Ally“ – und wie kann ich einer sein?
27. Februar 2021Weiterlesen Für die LSBTIQ* Community ist ein Ally eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person, die queere Menschen unterstützt und sich für ihre Rechte und Anliegen einsetzt. Hier gibt es jedoch kein allgemeingültiges Regelwerk: Ein Ally muss sich bilden, einsetzen, handeln, und aus Fehlern lernen können. Wie Expert*innen dem Oprah-Magazin mitteilten gibt es dabei jedoch Richtlinien, die dabei helfen können, ein guter Ally zu sein. Das erste ist dabei die Anerkennung des eigenen Privilegs und dessen Einsatz zum Guten. Dieses äußert sich beispielsweise schon darin, dass eine cisgeschlechtliche Person keine Sorge haben muss, am Arbeitsplatz für ihre Geschlechtsidentität angegriffen zu werden – während das Nationale Zentrum für transgeschlechtliche Gerechtigkeit in den USA fand, dass dort über drei Viertel von trans Menschen Diskriminierung erfahren. In Deutschland erleben laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes 67,4 Prozent – fast drei Viertel – soziale Herabwürdigung. Dagegen kann sich ein Ally einsetzen, indem sie/er Menschen korrigiert, wenn sie trans Kolleg*innen mit den falschen Pronomen ansprechen („misgendern“) – auch, wenn die betroffene Person gar nicht da ist. Außerdem sollte sich ein Ally immer gegen Beleidigungen oder queer-feindliche Witze aussprechen. Nicht nur in konfrontativen Situationen jedoch kann Allyship (Engl.: „Verbundenheit“) geübt werden: Wer in ihrer/seiner E-Mail-Signatur Pronomen angibt, de-stigmatisiert auch die Pronomens-Angabe für trans oder nicht-binäre Personen. Und wer sich dabei unsicher über die (Hinter-)Gründe dieser Themen ist, sollte sich als Ally selbst fortbilden, recherchieren, lesen, und zuhören, und erst dann informierte Fragen stellen – anstatt die Erwartung zu haben, alles von queeren Menschen erklärt zu bekommen. Umso offener man bei dem Stellen informierter Fragen ist, desto leichter wird es zu lernen und effektiv zu kommunizieren, so Menschenrechtsaktivistin Maybe Burke: „Lass Leute von Anfang an wissen, dass Du für Anleitung und Feedback offen bist“. Wie der schwule Journalist Carlos Maza in seiner Anleitung schreibt: Als Ally sollte man den queeren Menschen im eigenen Umfeld zuhören, sie fragen, wie es ihnen geht, und sich dabei bewusst machen, dass sie potentiell Dinge durchgemacht haben (oder noch immer durchmachen), die für eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person unvorstellbar sind – und dabei Unterstützung anbieten wo es geht, ohne sich in die Rolle des „Retters“ zu begeben. Der Weg zur Gerechtigkeit muss gemeinsam gegangen werden, und nicht-queere Menschen tragen dabei die gleiche Verantwortung wie LSBTIQ* - nur wer dies spürt und sich über das eigene Handeln nicht profiliert kann ein wahrer Ally sein.
Weiterlesen Denn durch die Pandemie sind viele LSBTIQ-Vereine in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Wie Queer.de berichtete hatte die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung (hms) deswegen schon im vergangenen Jahr 20.000 Euro in Unterstützungen ausgezahlt. Diese Jahr läge der Fokus jedoch auf dem Erhalt queerer Räume außerhalb der Großstädte, und auf der Aufrechterhaltung von Angeboten für von der Krise besonders betroffene LSBTIQ, wie unter anderem queere Geflüchtete, Sexarbeiter*innen, und Obdachlose. Warum die Unterstützung queerer Projekte so wichtig ist, geht aus der Erzählung der promovierenden Person Francis Seeck hervor, die*der in einem Interview zu den Effekten der Pandemie auf queere Menschen schildert: „Für eine Interviewpartnerin, die chronisch krank, älter und von Klassismus betroffen ist, hatte die Krise ganz dramatische Auswirkungen. Sie musste aus einem Hausprojekt in der Großstadt zurück in ihr Heimatdorf ziehen, wo sie nicht mehr geoutet als trans* Person leben kann und von Isolation und Ausgrenzung betroffen ist. Sie meldete sich mit suizidalen Gedanken bei mir.“ Außerdem seien überdurchschnittlich viele trans und nicht-binäre Personen von Einkommensausfällen betroffen, da sie oft im sogenannten „purple collar“-Dienstleistungssektor arbeiten, zum Beispiel in queeren Bars oder prekär freiberuflich. Seeck sieht daher in der Krise eine große Gefahr für die queere Gemeinschaft: „Ich frage mich, welche queeren Bars und Räume nach der Corona-Krise noch bestehen werden“. Deswegen sind Soli-Fonds wie die der hms von so großer Wichtigkeit für den Fortbestand solcher Räume. Gemeinnützige Vereine können hier einen Antrag stellen, wenn sie den folgenden Förderkriterien entsprechen:
#NoHateMe – Kampagne gegen digitales Mobbing
6. Februar 2021Weiterlesen „Hass im Netz existiert nicht losgelöst vom analogen Leben, sondern greift reale Macht- und Diskriminierungsstrukturen auf, aus denen er sich speist. Zusätzlich lässt sich im Internet eine Art Enthemmungseffekt beobachten. Meinungen, die im realen Leben oft nur von einer Minderheit offen vertreten werden, sind mit wenigen Klicks veröffentlicht und finden im Internet eine große Bühne.“ schreibt die Initiative auf ihrer Homepage. Das wichtigste Ziel der Studierenden und jungen Menschen, die sich bei NoHateMe engagieren, ist die Präventionsarbeit gegen digitales Mobbing bzw. Cyber-Mobbing und Hate Speech. Dies soll unter anderem durch Förderung von Medienkompetenz, der Stärkung von Selbstvertrauen und der Vermittlung von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten erreicht werden. Betroffene sollen informiert werden, welche Rechte sie im Internet haben, und wie man sich gegen Hass und Diskriminierung im Netz zur Wehr setzen kann. Auch Bildungs- und Aufklärungsarbeit wird durch das Projekt geleistet, zum Beispiel durch Workshops in Schulen und Jugendzentren. Über die Webseite von Liebe wen Du willst können außerdem Vorfälle gemeldet werden, und darüber beraten werden, ob eine strafrechtliche Verfolgung Sinn machen kann. Erreichbar ist die Initiative auch über Facebook und Instagram.