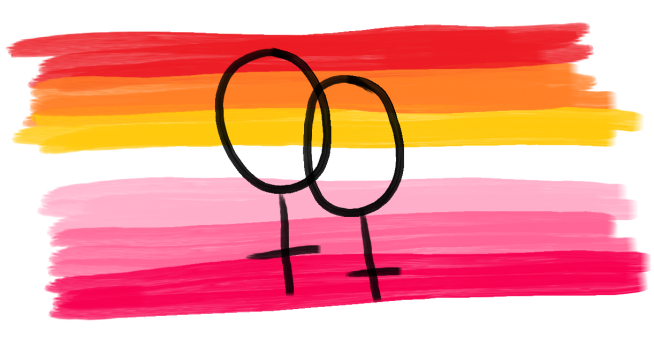Weiterlesen Die Polizei meldete der Hauptstadt am Sonntag, dass die jugendlichen Frauen zunächst homofeindlich beleidigt und diskriminiert, und anschließend brutal geschlagen wurden. Wie queer.de berichtete, hielten sich die jungen Frauen gerade im Park am Gleisdreieck auf, als die drei unbekannten Täter*innen auf sie zukamen, mit Fäusten auf sie einschlugen und nach ihnen traten. Die 14-Jährige erlitt hierbei Verletzungen an den Rippen und am Rücken, ihre Begleiterin im Gesicht und am Hinterkopf. Bevor die Schläger*innen sich vom Tatort entfernten, entrissen sie der 14-Jährigen die Handtasche mit Portemonnaie und Handy, wobei letzteres mutwillig beschädigt wurde. Anschließend erstatteten die beiden verletzten Jugendlichen auf einem Polizeiabschnitt Anzeige gegen Unbekannt und haben vor, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Wie bei Hasskriminalität üblich, führt der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen des homophoben Übergriffs, nähere Angaben zu den drei Angreifer*innen wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Weil Hassverbrechen aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Berliner Polizei gezielt publiziert werden, werden diese vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit gemeldet. Nach wie vor besteht hier allerdings eine große Dunkelziffer, nicht nur was körperliche, sondern auch verbale Angriffe anbelangt. Weil es jedoch sehr wichtig ist, dass diese Verbrechen sichtbar und geahndet werden, gibt es bei der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft eigene Ansprechstellen für LGBTI. Unterstrichen wird dies mit der Aussage: „Nehmen Sie Gewalt und Diskriminierung nicht hin! Holen Sie sich Unterstützung! Erstatten Sie Anzeige!“. Erfahren Sie hier mehr über eine Untersuchung zu lesbenfeindlicher Gewalt in Berlin.
Lesben
Woher kommt eigentlich der „Pride Month“?
8. Juni 2021Weiterlesen Pride Versammlungen sind in den mühsamen Geschichten unterdrückter Gruppen verwurzelt, die seit Jahrhunderten darum kämpfen von der Gesellschaft akzeptiert zu werden und Vorurteile zu überwinden. Warum im Juni? Die ursprünglichen Organisator*innen wählten diesen Monat, um die Stonewall-Aufstände im Juni 1969 in New York City zu ehren, welche unter anderem die moderne Gay Rights („Schwule/Lesbische Rechte“) Bewegung entfacht haben. Bei den Stonewall-Aufständen veranstaltete die Polizei in den frühen Stunden des 28. Junis eine Razzia in der Schwulenbar „Stonewall Inn“, und begann Kund*innen nach draußen zu schleppen. Als diese sich der Verhaftung widersetzten und eine Gruppe von Unbeteiligten begann, die Polizei mit Flaschen und Münzen zu bewerfen eskalierten die Spannungen schnell. New Yorks schwule und lesbische Community, die seit Jahren von der Polizei schikaniert worden war, brach in Nachbarschaftsaufständen aus, die drei Tage lang anhielten. So wurden sie zu einem Katalysator für aufstrebende Gay Rights Bewegungen, indem sich Organisationen wie die Gay Liberation Front und die Gay Activists Alliance formierten, modelliert nach der Bürgerrechtsbewegung und der Frauenrechtsbewegung. Mitglieder veranstalteten Proteste, trafen sich mit Politiker*innen und unterbrachen öffentliche Veranstaltungen um dieselben Politiker*innen zum Handeln zu bringen. Ein Jahr nach den Stonewall-Aufständen fanden in den USA die ersten Gay Pride Märsche statt. 2016 wurde der Bereich um das Stonewall-Inn als nationales Monument gekürt. Daher finden bis heute noch die meisten Pride Veranstaltungen im Juni statt, wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Im Jahr 2020 wurden viele dieser Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt, aber Umzüge und andere Feierlichkeiten werden dieses Jahr in Hamburg, Berlin, und vielen anderen Städten höchstwahrscheinlich wieder stattfinden. Woher kommt der Name und die Flagge? Der Name „Pride“ wird Brenda Howard, einer bisexuellen New Yorker Aktivistin zugeschrieben, deren Spitzname die „Mutter von Pride“ ist. Sie organisierte den ersten Pride Umzug, um dem Jahrestag des Stonewall-Aufstandes zu gedenken. Die Pride-Flagge wurde 1978 von dem Künstler und Designer Gilbert Baker entworfen, der von Harvey Milk – einem der ersten offen schwulen Politikern in den USA – beauftragt wurde eine Flagge für die Pride-Feiern zu entwerfen. Baker, ein prominenter Gay Rights Aktivist, orientierte sich dabei an den Streifen der US-Amerikanischen Flagge, nutzte jedoch die Farben des Regenbogens, um die vielen verschiedenen Gruppen innerhalb der Community zu reflektieren. Wer darf bei Pride mitfeiern? Pride wird von Menschen zelebriert, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht automatisch von der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft gefeiert wird. Weil Cis-Geschlechtlichkeit, hetero-Liebe, und hetero-Sex in der Mehrheitsgesellschaft als richtig gelten, und diese Orientierungen und Identitäten ständig in den Mainstream-Medien gezeigt werden, braucht es deshalb auch keinen „Straight Pride Month“ (Hetero-Stolz Monat). Das bedeutet jedoch nicht, dass Cis-hetero Menschen nicht auch als Verbündete an den Veranstaltungen teilnehmen können – indem sie Freund*innen begleiten und sie feiern, zuhören und lernen, oder sich bei einer Gruppe freiwillig engagieren.
Queerer Widerstand in der DDR
12. Mai 2021Weiterlesen Sie kritisieren, wie Beyer dem Tagesspiegel in einem Interview sagte, dass die zahlreichen Einzeldarstellungen der Bewegung fast ausschließlich von den damaligen Aktivist*innen selbst stammen. Eine systematische Aufarbeitung der mehr als zehnjährigen Emanzipationsgeschichte der queeren Menschen in der DDR gibt es jedoch nicht – obwohl es dafür mehr als genug Daten und Unterlagen gäbe. Über Beyer selbst habe die Staatssicherheit 1984 einen sogenannten Operativen Vorgang angelegt, deren Akte allein 10.000 Seiten über einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren umfasst. Schon daran ist erkennbar, „wie aktiv die Ost-Berliner Lesben- und Schwulenbewegung war und wie vehement der DDR-Staatsapparat darauf reagiert hat“. Als Aktivist*innen versuchten, Akteneinsicht zum Thema „Lesben und Schwule in der DDR und deren Gruppen“ zu bekommen, wurde ihre Forschung durch eine Namensschwärzung behindert. Diese wurde damit begründet, dass das Thema unter die Rubrik „Sexualität“ falle und deswegen als „Privatangelegenheit“ behandelt würde. Diese Art von Argumentation sei auch damals von der SED und Stasi gegenüber den Lesben- und Schwulengruppen in der DDR verwendet worden, erklärte Beyer. Aber, „Homosexualität ist und war schon immer ein Politikum“. Wenn die Lesben- und Schwulenbewegung als eine Widerstandsbewegung innerhalb der DDR-Diktatur angesehen würde, der es um grundsätzliche Fragen wie Sexualität, Selbstbewusstsein, Selbsthass und Anti-Homosexualität ging, könnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. „Gleichzeitig war damit auch immer die Kritik an allgemeinen gesellschaftlichen Strukturen verbunden“. Die Ursachen und Hintergründe zur Entstehung dieser Widerstandsbewegung in der DDR seien fast völlig in Vergessenheit geraten, obwohl es so wichtig sei, so Beyer, dass diese Geschichte erforscht und erzählt wird: Welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf das eigene und das Leben anderer haben, und „in welche harten Konflikte man auf einmal mit Freunden, in der Schule und auch mit bestimmten strukturellen und auch Systemfragen gerät“, wenn man sich in der DDR als queer outete. Beyer würde sich deswegen wünschen, dass junge Menschen ihre Queerness als ein Politikum verstehen und ihre gesellschaftspolitische Relevanz begreifen. Diese Erkenntnis habe bei den damaligen Aktivist*innen in der Diktatur ganz persönliche Kräfte freigesetzt. „Diese Menschen waren damals mutig und sie haben sich in Gefahr begeben. Sie hätten auch ins Gefängnis kommen können.“ Allerdings seien relativ wenige verhaftet worden, gerade in Gruppen: Die Solidarität unter queeren Menschen habe sie in der DDR unheimlich stark und unabhängig gemacht, und befähigt, „ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“. Und Beyer ist überzeugt, „das ist für queere Menschen heute noch genauso relevant“.
Weiterlesen Ausführlich kommen auch Zeitzeug*innen zu Wort, die der Autor für seine Studie in sogenannten Oral History Interviews befragt hat. Zu zum Beispiel auch Frau Schmidt. Diese berichtet in dem Buch über ihre Erfahrungen als „Politlesbe“: „Ich werd jetzt 65. Ich bin, war sehr engagiert auch in der Szene und hab ganz viel aufgebaut in E. Ich bin ’ne Politlesbe, sag ich jetzt mal so salopp. Also ich hatte auch so ’nen Ruf, dass ich ’ne Mackerfrau wär, weil ich mich gegenüber Männern sehr energisch durchsetzen konnte. Ich hab auch ein sehr ausgeprägtes Rechtsbewusstsein. Wenn mir Unrecht geschieht, dann kann ich ziemlich wütend werden.“ Das Buch nimmt die Position ein, dass Gefühle, in Empfindungen und im Ausdruck, von sozialen und kulturellen Kontexten geprägt sind. Gammerl ordnet die Gefühle seiner Protagonist*innen also in einen zeitgeschichtlichen Kontext ein. Drei große Kapitel und Epochen strukturieren das Buch: "Nachkriegsdekaden: Ausweichen", die 1970er-Jahre: Aufbrechen!" sowie "1980er-Jahre: Ankommen". Der Autor betont jedoch, dass diese Periodisierung nicht einer eindeutig linearen Entwicklung von Emanzipation zuzuordnen ist. Das Wichtigste, so berichtet Gammerl in einem Interview, sei für ihn die Gleichzeitigkeit von Stigmatisierung, Emanzipation und Normalisierung darzustellen. Es habe sich vieles zum Guten verändert, doch nach wie vor gebe es Ausgrenzung. Es gelte, sich mit der Komplexität unterschiedlicher Gefühlslagen auseinanderzusetzen. Außerdem sei es ihm als schwulem Historiker auch ein persönliches Anliegen gewesen, zu dem Themenfeld zu arbeiten. Eine positive Rezension zum Buch ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen: „Die Fülle der Lebensentwürfe, die hier zur Sprache kommen, ist atemberaubend und kaum resümierbar. Man kann das Buch überall aufschlagen und eintauchen. Lesbische Mütter und schwule Väter gab es längst vor den neuen Patchworkfamilien, lebenslange Partnerschaften selbstverständlich vor der Einführung der ‚Ehe für alle‘“.
Weiterlesen Die „Prolosesben“ oder „Prolllesben“ schufen ihre Selbstbezeichnung als Begriff, um ihre Klassenherkunft in Abgrenzung zu bürgerlichen Lesben deutlich zu machen. Die Entstehung der Proll-Lesbengruppen ist eingebettet in eine historische Entwicklung in der Frauen- und Lesbenbewegung, innerhalb derer Differenzen zwischen verschiedenen Frauen sichtbar gemacht wurden. So bildeten gleichzeitig zum Beispiel auch schwarze oder migrantische Frauen eigene Gruppen und Netzwerke. In ihren eigenen Kleingruppen betrieben die Frauen Selbsterfahrung und tauschten sich über Ausgrenzungserfahrungen in der politischen Szene aus. Martina Witte, die selbst Mitglied einer solchen Gruppe war, berichtet in einem Aufsatz darüber: „In den Prolo-Lesbengruppen wurden nun konkrete Unterschiede, welche die soziale Herkunft betrafen, benannt und untersucht. Durch den Austauschzeigte sich, dass Strukturen der Abwertung, der Ausgrenzung, der Verleugnung und dergleichen hinsichtlich sozialer Herkunft allen aus der Gruppe bekannt waren.“ Innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung boten die Aktivist*innen der Prololesben auf Veranstaltungen Workshops an oder beteiligten sich mit Texten und Flyern an Debatten. Eine Gruppe richtete ein „Umverteilungskonto“ ein: Darauf konnten besser situierte Lesben einzahlen, und ärmere Lesben anonym Geld abheben. An der Organisation der Lesbendemo im Jahr 1990, die mit über 1000 Teilnehmer*innen besucht wurde, waren Proll-Lesben ebenfalls beteiligt.
Das Archiv der anderen Erinnerungen
23. April 2021Weiterlesen Ziel der Initiative ist es, die (historischen) Lebenswelten von LSBTIQ zu bewahren und auch für zukünftige Generationen sichtbar zu machen. Dabei steht die Frage im Zentrum, auf welche Weise die persönliche Lebensgeschichte mit Fragen der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität verbunden ist. Die konkreten, persönlichen und unterschiedlichen Erfahrungen der befragten Personen sollen das Spektrum der LSBTIQ-Geschichte erweitern. Das Team des Projektes besteht aus freien Mitarbeiter*innen verschiedener Hintergründe und unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identitäten. Alle vereint das Interesse für die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation von LSBTIQ. Im Dezember 2013 wurde mit der Durchführung der Videointerviews begonnen. Bislang sind 57 Interviews entstanden. Forscher*innen können nach einer Anfrage das Material für ihre Forschungsvorhaben nutzen.
Das homo- oder bisexuelle Coming-out
22. April 2021Weiterlesen Da in der Gesellschaft auf Grund von Heteronormativität oftmals davon ausgegangen wird, dass jemand heterosexuell lebt, ist es für nicht-heterosexuelle Menschen oftmals eine bewusste Entscheidung, ob und wann sie ihre Identität anderen gegenüber offenlegen, sich also „outen“ wollen. Insbesondere das erste Coming-out gegenüber Freunden und Familienangehörigen kann ein entscheidendes Erlebnis im Leben von Schwulen, Lesben und Bisexuellen sein. Einigen ist ein Coming-out gegenüber vielen Personen wichtig, um nicht-heterosexuelle Orientierungen sichtbar zu machen. Andere möchten sich in bestimmten Kontexten nicht outen, da sie Angst vor negativen Reaktionen, Ablehnung und Vorurteilen haben. Oder es gibt Menschen, die ihre sexuelle Orientierung nur beiläufig oder wenn es explizit zum Thema wird, erwähnen. Auf jeden Fall ist das Coming-out eine persönliche Entscheidung und sollte selbstbestimmt erfolgen, und nicht auf Druck von anderen entstehen. Weiß das Umfeld noch gar nichts von der eigenen sexuellen Orientierung so sollte man sich zunächst Personen anvertrauen, die einen auf jeden Fall unterstützen. Sinnvoll ist es außerdem, den Personen, gegenüber denen man sich geoutet hat, mitzuteilen, ob sie diese Information vertraulich behandeln sollen. Kontakt zu anderen schwulen, lesbischen oder bisexuellen Personen, die sich bereits geoutet haben, kann ebenfalls hilfreich sein. Bei negativen Reaktionen nach einem Coming-out sollte der Kontakt zu Vertrauenspersonen gesucht werden oder im Falle von homofeindlichen Reaktionen, zum Beispiel im beruflichen Kontext, ggf. sogar rechtliche Schritte eingeleitet werden. Auch Beratungsstellen unterstützen bei Fragen zum Coming-out und dem damit verbundenen Umgang mit Ausgrenzung und Abwertung. Wenn eine Person in Ihrem Umfeld sich outen möchte: Bieten Sie der Person Unterstützung an, und haben Sie ein offenes Ohr, wenn die Person danach über die Reaktionen berichten möchte. Tauschen Sie sich darüber aus, was im Falle negativer Reaktionen Handlungsoptionen sind. Informationen für Eltern, die ihr Kind beim Coming-out unterstützen möchten, hat die Bundeszentale für gesundheitliche Aufklärung in einer Broschüre zusammengestellt.
Weiterlesen Statistiken zu Homophobie würden Lesben tendenziell unsichtbar belassen, so die Autor*innen der Studie. Bisherige Studien zu lesbenfeindlicher Gewalt zeigten jedoch, dass diese mangelnde Repräsentanz lesbischer Frauen aber nicht darauf zurückgehe, dass dies weniger von Gewalt betroffen seien. Frauen neigen zudem laut der Forschung dazu, homophobe Beleidigungen eher hinzunehmen, da sie durch den alltäglichen Sexismus an Abwertungen gewöhnt seien. Für die Untersuchung wurden 188 Teilnehmer*innen befragt. Von diesen bezeichnen sich die meisten als weiblich (87 %) bzw. divers (14 %) und lesbisch (58 %) bzw. queer (35 %). Die meisten Befragten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und 28 % sind nach eigener Einschätzung oft als lesbisch/queer sichtbar. Die Befragten schildern, dass die Gewalt gegen sie überwiegend im öffentlichen Raum stattfindet und zumeist von Einzelpersonen ausgeht. Beschimpfungen und Beleidigungen werden als häufigste Form von Gewalt genannt. Ein Nicht-Eingreifen Unbeteiligter in solchen Situationen wird als besonders verletzend empfunden. Gewalt im persönlichen Umfeld von Betroffenen wird zwar weniger häufig benannt, wird aber oft als belastender empfunden. Viele lesbische Frauen treffen Vorsichtsmaßnahmen, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Sie weisen verschiedenen Orten in der Stadt ein Gefühl von Unsicherheit oder Sicherheit zu, es ließen sich daraus jedoch keine allgemeineren Schlüsse bezüglich bestimmter Bezirke ableiten. Berlin werde zwar insgesamt als „Zufluchtsort“ erlebt, doch das Sicherheitsgefühl der Befragten hat in den letzten Jahren abgenommen. Verschränkungen mit anderen Diskriminierungsformen spielen bei Gewalt gegen Lesben eine große Rolle. Bei lesbenfeindlicher Gewalt verschränken sich fast immer Homophobie und Sexismus. Dies macht diese Form der Gewalt im öffentlichen Bewusstsein eher unsichtbar und führt möglicherweise auch mit dazu, dass die Dunkelziffer bei lesbenfeindlicher Gewalt besonders hoch zu sein scheint. Das bestätigt sich auch in der Befragung: Von 188 Befragten berichtet über ein Drittel von lesbenfeindlicher Gewalt oder übergriffigem Verhalten im vergangenen Jahr. Doch nur jeweils 3 % wendeten sich an eine Beratungsstelle oder zeigten die Tat bei der Polizei an. Insgesamt wurden im Jahr 2018 48 Fälle durch Beratungsstellen und Polizei registriert. Viele Befragten nehmen an, dass die Polizei nichts unternehmen wird oder unternehmen kann, und wenden sich daher nicht an sie. Zu den Gründen, warum lesbenfeindliche Gewalt in der Öffentlichkeit verhältnismäßig unbemerkt bleibt, äußert sich auch Albrecht Lüter, einer der Autor*innen des Berichts, in einem Interview: „Wir haben es hier mit vorrangig privaten Bewältigungsformen zu tun, die die Öffentlichkeit nicht erreichen. Zum einen ist es so, dass es in der Schwulenszene eine professionellere und längere Auseinandersetzung mit Antigewaltarbeit gibt. Außerdem wird die Polizei als maskuline Organisation wahrgenommen, der man eher mangelnde Sensibilität für die Belange und Gefühlswelt nach einem Angriff auf lesbische und bisexuelle Frauen unterstellt, deshalb wird die Polizei als Institution gemieden“ so Lüter. Als einen weiteren Punkt nennt er die bereits thematisierte Überschneidung von Lesbenfeindlichkeit und Sexismus. Gewalterfahrungen einer lesbischen Frau betreffen diese als Frau und als Lesbe. In einer heterosexistischen Gesellschaft seien solche Übergriffe normalisiert und würden daher nicht polizeilich angezeigt. Lesbenfeindliche Gewalt wird auch innerhalb von LSBTIQ*-Communities beschrieben, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Solche Vorfälle werden ebenfalls als besonders belastend beschrieben, da sie sich in Räumen ereignen, die eigentlich als Rückzugs- und Schutzorte fungieren sollten. Insgesamt wünschen sich die Befragten stärkere gesellschaftliche Bemühungen in Bezug auf ihre spezifische Problemlage, beispielsweise Aktionen für mehr Solidarität und Zivilcourage.
Paula hat zwei Mamas: Rechtliche Diskriminierung von Regenbogenfamilie verfassungswidrig
2. April 2021Weiterlesen Das Sorgerecht hat bisher nur die biologische Mutter Gesa, ihre Frau Verena müsste den langen Weg einer Stiefkind-Adoption gehen. Das Paar sah seine Grundrechte durch die bestehende Rechtslage verletzt und klagte dagegen. Das Oberlandesgericht Celle entschied nun: Das bestehende Abstammungsrecht ist verfassungswidrig.Der gemeinsame Entschluss beider Partnerinnen sei in diesen Fällen die Voraussetzung dafür, dass neues Leben entstehe. Der hierdurch gegenüber dem Kind begründeten Verpflichtung folge zugleich das Recht, die Pflege und Erziehung des Kindes wahrnehmen zu können, heißt es in der Urteilsbegründung. Das Bundesverfassungsgericht muss nun über den Fall entscheiden. Dies hätte wohlmöglich eine Gesetzesänderung und eine Reform des Abstammungsrechts zur Folge.
lesbisches Wohnprojekt benötigt Geld
27. März 2021Weiterlesen Wie das Berliner Queer-Magazin Siegessäule nun berichtet, fehlen dem Projekt rund eine Million Euro. Die Mittel werden unter anderem für die Projektsteuerung, fachliche Beratung und für die Ausstattung sowie langfristige Sicherung des Wohnprojekts benötigt. Derzeit versucht die Projektgruppe, das Geld über Anträge und Spenden zu akquirieren. Jutta Brambach, Projektleiterin, sieht aber auch die Politik in der Pflicht: „Es braucht einfach mehr – wenn man ein Leuchtturmprojekt lesbischer Sichtbarkeit wirklich umsetzen möchte. Die Politik muss auch Geld in die Hand nehmen. Das geht dann nicht anders.“ Unter rut-wohnen.de finden Sie weitere Informationen, wie das Projekt mit einer Spende unterstützt werden kann.