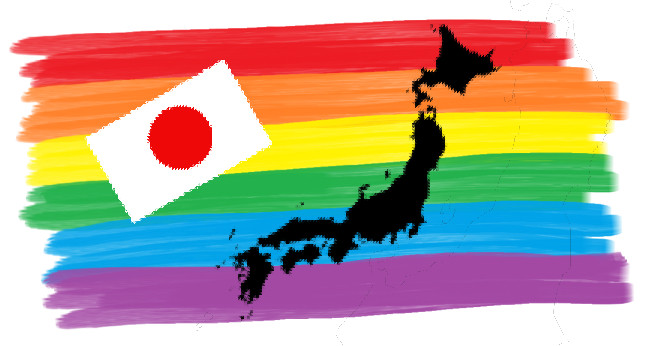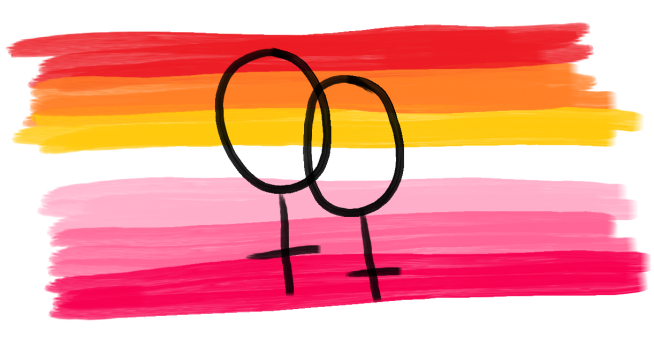Weiterlesen Japan hat als bisher einziger G7-Staat die „Ehe für alle“ bisher nicht anerkannt. Nun entschied in der nordjapanischen Stadt Sapporo ein Bezirksgericht, dass Weigerung Japans, gleichgeschlechtliche Ehen offiziell anzuerkennen, das verfassungsmäßige Recht auf Gleichbehandlung verletzt. 2019 hatten mehrere Paare von verschiedenen Gerichten des Landes gegen ihre Diskriminierung geklagt und verlangten außerdem eine Entschädigung für das Unrecht. Vor dem Gericht in Sapporo hatten drei Paare geklagt. Das Urteil von Sapporo könnte nun wegweisend für weitere Gerichtsverfahren sein. Aktivist*innen begrüßten das Urteil. Die Anwälte der Kläger*innen betonten, es handle sich um "einen großen Schritt hin zur Gleichberechtigung bei der Ehe". Ob der Gesetzgeber nun jedoch die notwendigen Reformen einleitet, um die gleichgeschlechtliche Ehe endlich zu ermöglichen, ist weiterhin unklar. Für eine Gesetzesänderung ist eine Mehrheit im Parlament von Nöten. Laut Umfragen befürwortet inzwischen jedoch eine Mehrheit der Japaner*innen die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Einige Gemeinden haben bereits in den letzten Jahren Partnerschaften von homosexuellen Menschen eigenständig anerkannt. Hier können sich Paare ein Zertifikat als „gleichgeschlechtliche Lebenspartner“ ausstellen lassen. Eine solche Eintragung einer Partnerschaft ist zwar rechtlich nicht bindend, ist aber ein Schritt gegen alltägliche Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die gleichen Rechte wie heterosexuelle Ehepaare haben Menschen, die eine solche Lebenspartnerschaft eintragen lassen, jedoch auch weiterhin nicht.
Lesben
Über Jahrzehnte nahmen Gerichte lesbischen Müttern im Falle von Scheidungen ihre Kinder
19. März 2021Weiterlesen Gerichte der Bundesrepublik entzogen Müttern bis mindestens in die 1980er Jahre ihre Kinder – wenn bekannt wurde, dass die Mütter lesbisch lebten. Dies führte auch dazu, dass Frauen die Existenz einer Partnerin verbargen. Die erste historische Studie zu dem Thema hat nun erstmals einen Teil dieser Unrechtsgeschichte aufgearbeitet. In Auftrag gegeben wurde sie vom Land Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel stellte die Untersuchung mit dem Titel „…in ständiger Angst…“ im Januar diesen Jahres vor und entschuldigte sich für das entstandene Unrecht: „Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Frauen, die sich scheiden ließen, um in einer Liebesbeziehung mit einer Frau zu leben jahrzehntelang das Sorgerecht entzogen wurde. Die Studie deckt strukturelle Diskriminierungen lesbischer Mütter bis zum Jahr 2000 auf. Das ist bedrückend und beschämend zugleich“ so Spiegel. Die Studie, legt auch Gründe dar, die zu der Diskriminierung lesbischer Mütter führten. Dazu gehören, dass die gesellschaftlichen Erwartungen in den 50er, 60er und 70er Jahren an Frauen waren, sich als Ehefrau und Mutter ausschließlich der Familie zu widmen. Auch das bis 1977 gültige Schuldprinzip im Scheidungsrecht führte dazu, dass schuldig geschiedene Ehepartner*innen den Unterhalt verloren. Außerdem galt damaligen Wertvorstellungen gemäß eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft für das Kindeswohl als bedenklich. Verantwortlich für die Forschungsarbeit war die Historikerin Dr. Kirsten Plötz, welche die Studie für das Institut für Zeitgeschichte und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld durchführte. Sie befragte für die Studie auch betroffene Zeitzeug*innen, die sich bereit erklärt hatten in Interviews über ihre schmerzhaften Erfahrungen zu berichten. Im einem Interview mit dem Deutschlandfunk erläutert sie die Schwierigkeiten im Forschungsprozess, da kaum offizielle Quellen vorhanden sind. „Wir haben ein unglaubliches Quellenproblem“, so Plötz dazu. Sie betont auch, wie erst 1984 erstmals gerichtlich entschieden wurde, dass die Bindung und die Versorgung des Kindes wichtig seien und das Kind bei einer offen lesbisch lebenden Mutter belassen werden konnte. „Es gab eine Veränderung, aber sehr langsam“, kommentiert Plötz.
Queere Tiere – Über Homosexualität bei Tieren
12. März 2021Weiterlesen Denn bei rund 1500 Spezies konnte bisher gleichgeschlechtliches Liebes- oder Sexualverhalten beobachtet werden, bei 500 davon ist dies sogar wissenschaftlich gut dokumentiert. Darunter finden sich Säugetiere wie Elefanten, Delfine aber auch Insektenarten oder Vögel. In einigen Arten kommt gleichgeschlechtlicher Sex häufiger vor als bei anderen. So wird zum Beispiel bei japanischen Makaken lesbischer Sex immer wieder beobachtet. Ein weiteres bekanntes Beispiel sind die Bonobos. Diese haben nicht nur generell oft Sex ohne Fortpflanzungsabsicht und aus reinem Vergnügen, sondern sind auch oft bisexuell. Bonobos nutzen Sex, um soziale Bindungen zu festigen oder Spannungen abzubauen. Viele der Tiere sind dabei aber nicht ausschließlich homosexuell, sondern genau genommen bisexuell, denn sie paaren sich mitunter auch mit einem gegengeschlechtlichen Partner, um Nachwuchs zu zeugen. Bei den amerikanischen Bisons paaren sich Männchen und Weibchen nur ein Mal im Jahr, in der restlichen Zeit haben die Männchen auch untereinander Sex. Es gibt auch immer wieder Fälle, in denen gleichgeschlechtliche Tierpaare stabile Bindungen miteinander eingehen und sogar gemeinsam Jungen aufgezogen haben. Immer wieder werden Geschichten über „schwule“ Pinguinpaare in Zoos erzählt. So adoptierten im New Yorker Zoo zwei männliche Zügelpinguine, die seit sechs Jahren als ein Paar lebten, ein befruchtetes Ei und zogen das daraus entstehende Küken auf. Trotz dieser zahlreichen Beispiele war gleichgeschlechtlicher Sex unter Tieren in der Verhaltensbiologie lange Zeit ein Tabu-Thema. Dieser wurde als Dominanz- oder Kampverhalten interpretiert oder mit Hormonstörungen oder Fehlprägungen in Verbindung gebracht. Oder homosexuelles Verhalten bei Tieren wurde einfach ignoriert.
20 Jahre eingetragene Lebenspartnerschaft
24. Februar 2021Weiterlesen Teile der CDU stellten sich gegen die eingetragene Partnerschaft, oder CDU-geführte Bundesländer blockierten es im Bundesrat. Sie befürchteten, völlig unbegründet, dass die Lebenspartnerschaft gegen den besonderen Schutz von Ehe und Familie in der Verfassung verstoßen würde. Bundesländer mit CDU-Regierung klagten dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Dies entschied jedoch in einem Urteil in 2002 für das Gesetz und begründete dies folgendermaßen: "Ziel des Gesetzes ist es, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare abzubauen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, ihrer Partnerschaft einen rechtlichen Rahmen zu geben.“ Im Vergleich zur Ehe hatte die Lebenspartnerschaft die gleichen Pflichten, jedoch nicht die gleichen Rechte, zum Beispiel steuerrechtlich. Erst 2017 kam dann die Ehe für alle: Schwulen und Lesben wurde es endlich erlaubt zu heiraten, und ihre Ehe damit der Hetero-Ehe gleichgestellt.
Projekt Lesbisch* Sichtbar
18. Februar 2021Weiterlesen Die Projektmitarbeiterin Stephanie Kuhnen, Journalistin und Herausgeberin des Sammelbandes „Lesben raus! Für mehr lesbische Sichtbarkeit“ im Queerverlag, sprach mit dem L-Mag über das Vorhaben: „Einfach nur eine Lesbe in den Vorstand zu wählen, verändert die Strukturen nicht“ so Kuhnen. Daher sei Lesbisch* Sichtbar ein Strukturprojekt, welches unter anderem für den Berliner Senat Vorschläge mache, wie die Stukturen hin zu einer gesellschaftlichen Teilhabe von Lesben verändert werden können. Ein weiteres Ziel sei die Vernetzung von lesbischen Initiativen sowie das Schaffen von Allianzen insbesondere mit den schwulen und trans* Communitys in Berlin. Wichtig sei dabei auch die Einbeziehung verschiedener Perspektiven, denn Lesben seien keine homogene Gruppe: „Lesbisch ist ein dynamischer Begriff und eine sehr vielfältige Identität. Wir sprechen eher von einer Lebensform“, so Kuhnen.