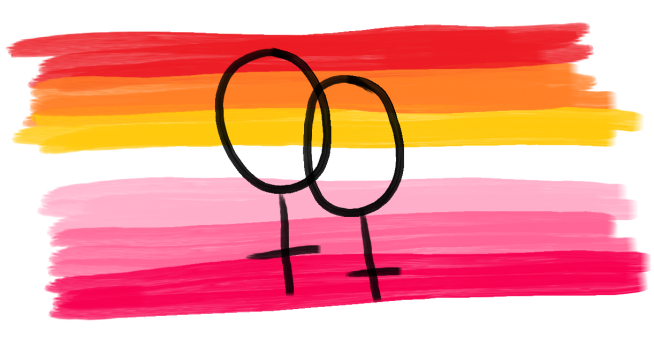50 Jahre SchwuZ: Symbol, Schutzraum oder Auslaufmodell?
19. August 2025Weiterlesen Auf seiner Webseite erklärte das Team: „SchwuZ hat Insolvenz angemeldet – aber wir kämpfen weiter.“ Als Rettungsmaßnahme wurde die sogenannte „Unlimited-Karte“ ins Leben gerufen, mit der Unterstützer*innen dem Club finanziell unter die Arme greifen können. In der Selbstbeschreibung heißt es: „Als einer der größten queeren Clubs Europas ist SchwuZ seit fast 50 Jahren mehr als nur ein Ort zum Feiern. Es ist ein Zuhause, ein Schutzraum, ein Ort für queere Kunst, Community und Widerstand.“ Gegründet 1977 in Kreuzberg, war das SchwuZ bereits zwei Jahre später Mitinitiator der ersten Christopher Street Day-Parade in Berlin und der Gründung des queeren Magazins Siegessäule. 2013 zog der Club in größere Räumlichkeiten nach Neukölln – mit Platz für bis zu 1.000 Feiernde. Doch dieser Schritt könnte sich rückblickend als riskant erwiesen haben, so die Bilanz des Guardian. Laut Rundfunk Berlin Brandenburg RBB teilte Insolvenzverwalterin Susanne Berner mit, dass vor allem die Folgen der Coronapandemie und das sogenannte „Clubsterben“ zur aktuellen Lage beigetragen hätten. Bereits im Mai kürzte das SchwuZ seine Öffnungszeiten, entließ ein Drittel der Belegschaft (33 Personen) und startete eine Crowdfunding-Kampagne, die lediglich 3.000 € von den angestrebten 150.000 € einbrachte. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind jedoch nicht allein pandemiebedingt. Inflation, steigende Mieten und eine sich wandelnde Partykultur setzen vielen Berliner Clubs zu. Auch Managementprobleme und eine alternde Stammkundschaft werden als Gründe genannt. In den Kommentarspalten des RBB-Artikels äußern Nutzer*innen Kritik: Die Lage des Clubs in einer dunklen Ecke Neuköllns sei abschreckend, die Preise zu hoch, die Musik veraltet. Dabei ist das SchwuZ ist nicht der einzige Club, der in jüngster Zeit schließen musste. Der Busche Club, gegründet 1988 in Ost-Berlin, machte nach 40 Jahren dicht. Auch das Watergate am Spreeufer schloss zum Jahreswechsel 2024 und die Wilde Renate kündigte ihr Aus zum Jahresende an – wegen eines Mietstreits. Diese Entwicklungen werfen eine grundsätzliche Frage auf: Wann wird ein Club zur Institution – und wann ist es Zeit für neue Formate? Die Antwort liegt nicht bei den Betreiber*innen, sondern bei den Nutzer*innen. Besonders bei kommerziell ausgerichteten Clubs wie dem SchwuZ muss kritisch hinterfragt werden, ob das Angebot noch zeitgemäß ist oder ob sich die Bedürfnisse der LSBTIQ*-Community verändert haben. Hinzu kommt: Die steigenden Mietpreise sind keine natürliche Entwicklung, sondern Entscheidungen von Immobilieneigentümer*innen (bzw. Immobilienunternehmen). Die Kommerzialisierung, wie wir sie in unserem Artikel zur World Pride 2023 in Sydney kritisiert hatten, ist bei Clubs nicht zwangsläufig problematisch – solange klar ist, dass nicht jede Einrichtung einen politischen oder symbolischen Anspruch erfüllen muss. Wenn sich Veranstalter jedoch auf die Symbolik berufen, müssen sie auch die Frage beantworten, welchen Beitrag sie über das reine Partyangebot hinaus leisten. Diese Frage stellt sich auch für potenzielle Investor*innen, die über die zukünftige Strategie des Clubs entscheiden. Das SchwuZ steht somit exemplarisch für eine größere Frage: Wann wird eine kulturelle Einrichtung zur Institution – und wann ist es an der Zeit, neue Räume, Formate und Bedürfnisse anzuerkennen, statt alte Strukturen um jeden Preis zu bewahren? Die LSBTIQ*-Szene braucht beides: Orte der Erinnerung und Orte der Erneuerung und sie braucht den produktiven Streit darum.