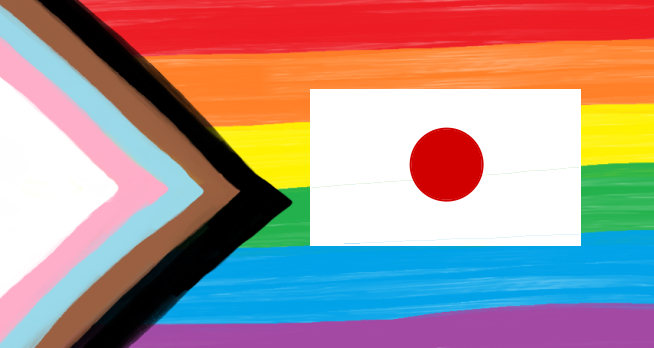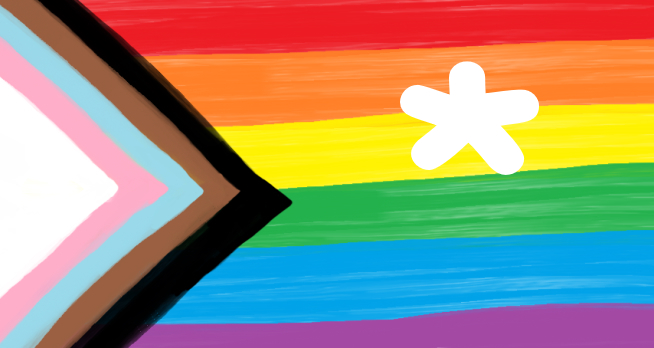Bereits Ende des vergangenen Jahres gab es eine positive Entwicklung der katholischen Kirche in Richtung LGBTIQ*-Rechte: Homosexuelle Paare dürfen nun offiziell gesegnet werden. Während dies einen wichtigen Schritt darstellt, gibt es auch Kritik, denn kirchlich heiraten können LGBTIQ*-Paare weiterhin nicht (echte vielfalt berichtete).
Im April diesen Jahres gibt es eine neue Diskussion der katholischen Kirche in Bezug auf queere Menschen. Die Erklärung „Dignitas infinita“ wurde nun nach fünf Jahren Diskussion und Bearbeitung veröffentlicht. Unter Punkt 55 der Erklärung über die unendliche menschliche Würde steht:
„Die Kirche möchte vor allem „bekräftigen, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, in seiner Würde geachtet und mit Respekt aufgenommen werden soll und sorgsam zu vermeiden ist, ihn ‚in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen‘ oder ihm gar mit Aggression und Gewalt zu begegnen“ […]. Aus diesem Grund muss es als Verstoß gegen die Menschenwürde angeprangert werden, dass mancherorts nicht wenige Menschen allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung inhaftiert, gefoltert und sogar des Lebens beraubt werden.“
So wird deutlich formuliert, dass die menschliche Würde von homosexuellen Personen verteidigt werden muss, was erstmal einen Fortschritt bedeutet. Gleichzeitig muss vermerkt werden, dass der Punkt über dem Überbegriff „Gender-Theorie“ steht, worunter in den vier darauffolgenden Punkten ausgeführt wird, dass die „gefährliche“ Theorie zu einer „ideologischen Kolonisierung“ führe und den wesentlichen Unterschied zwischen Menschen – Geschlecht auslöschen wolle.
Während Papst Franziskus also im Verhältnis zu weiten Teilen der katholische Kirche liberale Einstellungen in Bezug auf schwule und lesbische Katholik*innen zu haben scheint, die er bereits 2018 als von Gott erschaffen und geliebt beschrieben hat, werden trans Personen als Gefahr konstruiert, die die Grenzen zwischen Mann und Frau verblassen lassen (them). Im Wortlaut wird meist von „Gender-Theorie“ gesprochen, was oft als Platzhalter für Transgeschlechtlichkeit angewendet zu werden scheint.
So werden insbesondere trans, inter und nicht-binäre Personen von den Zugeständnissen der „Digntias infinita“-Erklärung ausgenommen. Geschlechtsangleichende Eingriffe, die im Wortlaut als „Geschlechtsumwandlungen“ beschreiben sind, würden die menschliche Würde bedrohen. Nur zur Behebung „genitale[r] Anomalien“ würden solche medizinischen Eingriffe erlaubt werden. (Geschlechtliche) Selbstbestimmung hingegen würde „der uralten Versuchung des Menschen nach[…]gehen, sich selbst zu Gott zu machen“, was der Vatikan in der Erklärung klar ablehnt.
Auch Leihmutterschaft wird in der Erklärung kritisiert, eine aus verschiedenen Gründen und Richtungen umstrittene Praxis, die jedoch insbesondere LGBTIQ*-Paaren zur Verwirklichung eines Kinderwunsches behilflich sein kann (siehe einen früheren Artikel von echte vielfalt). Ob die jetzige Erklärung also wirklich fortschrittlich für die LGBTIQ*-Gemeinschaft ist, kann diskutiert werden. Zumindest wird die Diskriminierung von Personen auf Basis ihrer sexuellen Orientierung nun explizit abgelehnt. Bei vielen anderen Punkten hat die katholische Kirche noch einen weiten Weg vor sich.
Schließen