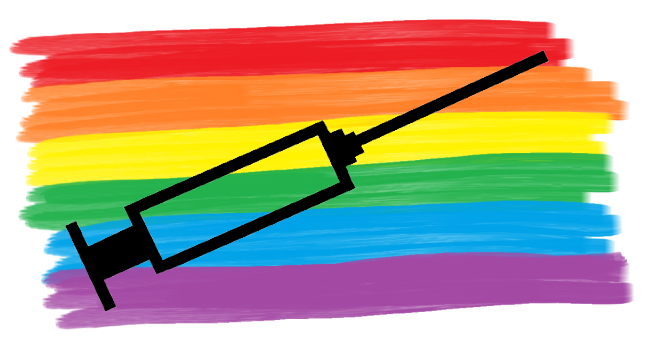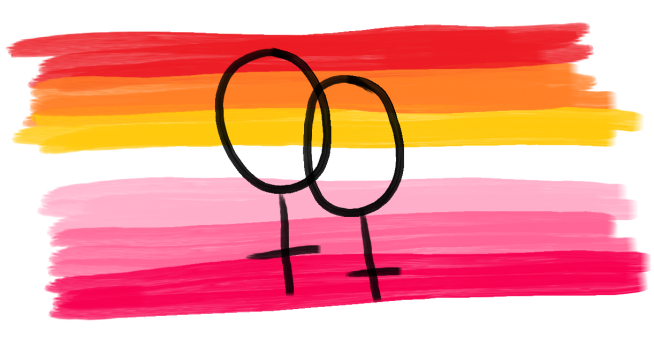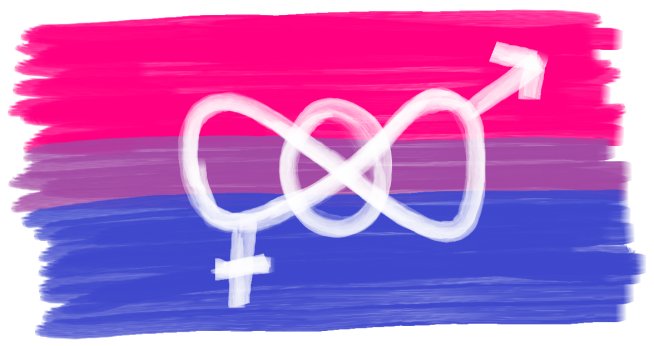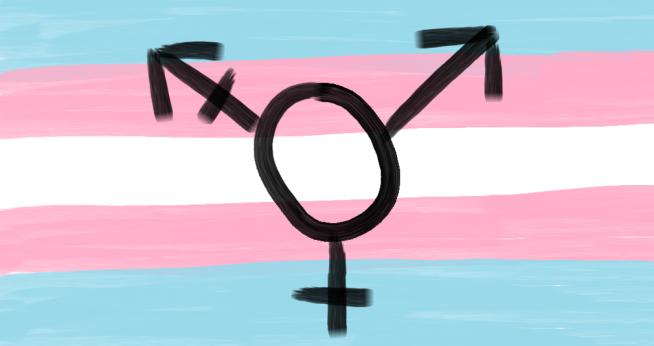Nadine ist 30 Jahre alt, lebt in Hamburg und ist bisexuell. Echte-Viefalt.de sprach mit ihr über ihre Erfahrungen als bisexuelle Frau.
Weiterlesen
Was bedeutet der Begriff Bisexualität für Dich?
Bisexualität bedeutet für mich, dass man keine sexuelle Präferenz nur ausschließlich für Frauen oder Männer hat bzw. eben nur für ein Geschlecht. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man auch als bisexuelle Person ein Geschlecht bevorzugt, und zum Beispiel eher Beziehungen und Dates mit Männern oder eher mit Frauen hat. Die eine Seite kann überwiegen, muss es aber nicht unbedingt.
Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich eher auf Frauen stehe und mich eher mit meiner ‚lesbischen Seite‘ identifizieren kann, allerdings hatte ich die meisten Beziehungen bisher eher mit Männern. Das hat sich einfach eher ergeben, da man halt mehr Möglichkeiten im Alltag hat Männer kennen zu lernen, und wenn man Frauen kennen lernen möchte, die auf Frauen stehen, dann muss man eher in der queeren Community unterwegs sein und zum Beispiel auf Events gehen, ansonsten wird das eher schwierig.
Wie verlief Dein Coming-Out?
Bei meinen Freunden musste ich das nie wirklich ansprechen, das ist einfach im normalen Miteinander herausgekommen oder einfach ganz normal gewesen, darüber zu sprechen. Zumal viele Freunde auch selber zum Beispiel bi- oder pansexuell sind.
Bei meinen Eltern hatte ich ein richtiges Coming-Out. Ich habe sie besucht und ihnen davon erzählt. Ich hatte davor etwas Angst, da ich auch bei anderen Dingen schon immer etwas anders war. Es war aber alles ganz entspannt, und meine Eltern haben mich getröstet, als ich dann vor Erleichterung kurz geweint habe.
Mit welchen Vorurteilen oder Diskriminierungserfahrungen hast Du zu tun?
Vorurteile habe ich persönlich keine erlebt. Man hört ja öfter mal von Vorurteilen wie „die können sich ja nicht entscheiden“ oder so, aber das ist mir selber nicht passiert. Diskriminierung habe ich in meinen lesbischen Beziehungen dahingehend erfahren, dass wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin spazieren gegangen bin, wir fast immer angesprochen worden sind. Sowohl im ,positiven‘ wie im negativen Sinne. Uns wurde zum Beispiel gesagt, dass wir ja besonders süß seien, das würde einem Hetero-Pärchen nicht passieren. Auf Parties wurden wir oft von Männern angebaggert, die das offenbar geil fanden, dass wir halt zwei Frauen sind, die was miteinander haben.
In der queeren Community wird mitunter der Vorwurf von Bi-erasure laut. Was ist Deine Meinung dazu?
Ich persönlich habe das nicht erlebt, aber habe davon gelesen, dass speziell bei Bi-Frauen ihre Bisexualität nicht immer ernst genommen oder als ‚Ausprobierphase‘ wahrgenommen wird. Ich habe auch mitbekommen, dass einige Lesben Angst haben, etwas mit einer Bi-Frau anzufangen, da diese glauben, sie könnten dann für einen Typen verlassen werden.
An sich finde ich Definitionen und das Einteilen in Kategorien oft eher anstrengend und Bi-Menschen sollten natürlich in der queeren Szene nicht ausgeschlossen werden. Man sollte sich eher auf die Persönlichkeit eines Menschen konzentrieren.
Was wünscht Du Dir von der queeren Community?
Ich wünsche mir weniger Vorurteile, und es sollte weiterhin ok sein, bisexuell sein zu dürfen. Ich bekomme in letzter Zeit öfter mit, das man fast schon dazu gedrängt wird, nicht mehr das Wort „bisexuell“ nutzen zu dürfen, sondern stattdessen pansexuell sagen, oder sein sollte. Es könnten sich sonst Gruppen wie trans Personen oder Non-Binaries ausgeschlossen fühlen. Ich finde aber, man sollte Menschen nicht dazu drängen, sich als pansexuell zu definieren, wenn sie sich eben als bi verstehen, und niemand sollte einer anderen Person ihre Sexualität vorschreiben. Allgemein wünsche ich mir außerdem weniger Anfeindungen untereinander und weniger Zwang, einem bestimmten Bild mit bestimmten politischen Ansichten entsprechen zu müssen. Bevor man einen politischen Ansatz als den absolut richtigen hinstellt, sollte man außerdem darüber diskutieren dürfen.
Was wünscht Du Dir von der Mehrheitsgesellschaft?
In den Medien gibt es kaum bisexuelle Charaktere. In Filmen und Serien sind diese entweder homo- oder heterosexuell, aber eben kaum bi. Ich würde mir zudem auch wünschen, dass es gar nicht so sehr zur Sprache kommt, wie die Sexualität von Menschen ist, und das Dinge einfach passieren.
Homo- und Bisexualität und andere sexuelle Orientierungen sollten in der Gesellschaft nicht mehr als unnormal empfunden werden. Es sollte auch nicht immer wieder betont werden, dass jemand homo- oder bisexuell ist, sondern einfach normal und ok sein.
Schließen