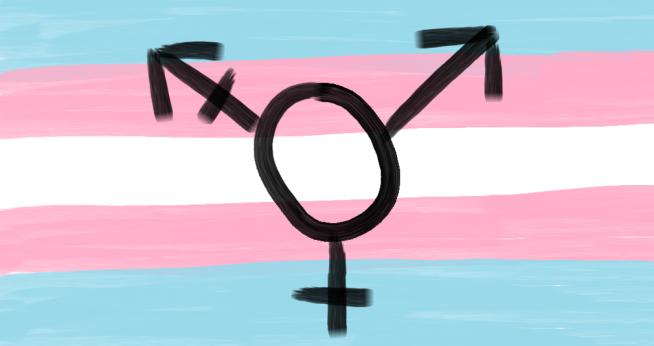Die Macht der Sprache: Warum wir „gendern“ sollten
15. Februar 2021Weiterlesen Spitz gesagt ließe sich argumentierten, dass dies allen Menschen, die nicht die Geschlechterkategorie „männlich“ passen, vermittelt, dass ihre sprachliche Repräsentation den vermeintlichen Mehraufwand des sogenannten „Gendern“ nicht wert sei. Gendern bedeutet in diesem Zusammenhang die Verwendung geschlechtsneutraler oder geschlechtsinklusiver Bezeichnungen: Oft unkompliziert einzusetzen durch Begriffe wie Teilnehmende, Demonstrierende, oder Lehrkräfte. In manchen Fällen – wie Schüler*innen, – jedoch, offenbart sich der „Mehraufwand“ darin, dass das Gender-Sternchen durch ein kurzes Innehalten im Redefluss gesprochen werden muss, oder in anderen Worten: Dass in der Sprache Platz geschaffen werden muss. Denn genau darum geht es beim Gendern: Um das sichtbar machen aller Geschlechter. Wie bedeutend Sprache in diesem Zusammenhang ist, spiegelt sich in der Aufregung wider, mit der das Bundesinnenministerium auf einen Gesetzestext der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht reagierte, weil sie ihn in weiblicher Form einreichte: Also zum Beispiel Geschäftsführerinnen statt, wie bisher üblich, Geschäftsführer. Dass ein Sprecher des Innenministeriums einräumte, dass das generische Femininum „zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachwissenschaftlich nicht anerkannt“ sei, und deswegen die Gefahr bestehe, dass das Gesetz nur für Frauen gelten könnte, mag rechts- und sprachwissenschaftlich gesehen wahr sein. Es zeigt jedoch auch, wie sich diese Machtstrukturen von der Wissenschaft, in die der Gesetzestexte, in die Medien, bis hin in unseren Alltag zieht: „Arzttermin“ ist deutlich üblicher als „Ärztinnentermin“. Und ja, es ist auch kürzer, wie „Schüler“ auch unkomplizierter als „Schüler*innen“ ist. Dieses Argument könnte man insbesondere in Bezug auf das ältere Publikum des ARD anbringen, und sich sorgen, dass dieses den Anschluss verlieren könnte, wenn plötzlich gegendert würde. Dies wirft jedoch die größere Frage danach auf, inwieweit sich Sprache entwickeln sollte, um die Realität widerzuspiegeln: Während Bezeichnungen wie „Lehrer“ oder „Ärzte“ eine Zeit lang zutreffend waren, weil Frauen* von diesen Berufen ausgeschlossen waren – wie von vielen anderen Lebensbereichen auch – so ist die Realität heute schon lange deutlich vielfältiger. Die Antwort darauf, warum wir gendern sollten, liegt also genau hier, in der Abbildung echter Vielfalt in der echten Sprache: Im Alltag, in den Medien, in den Gesetzestexten. Finden Sie hier ein geschicktes Gender-Wörterbuch.