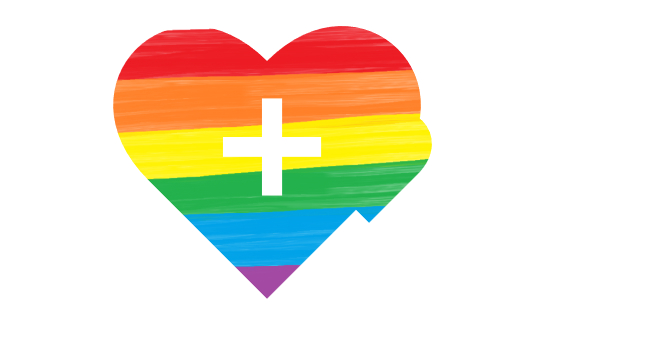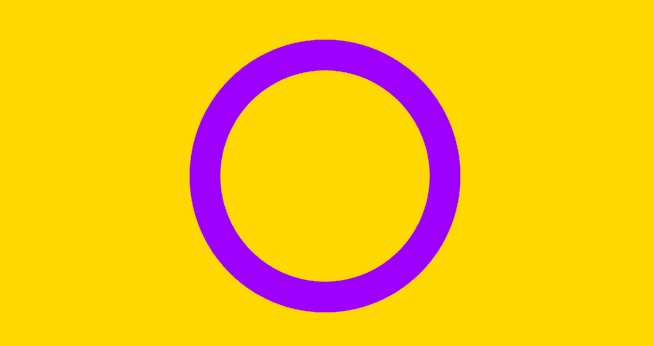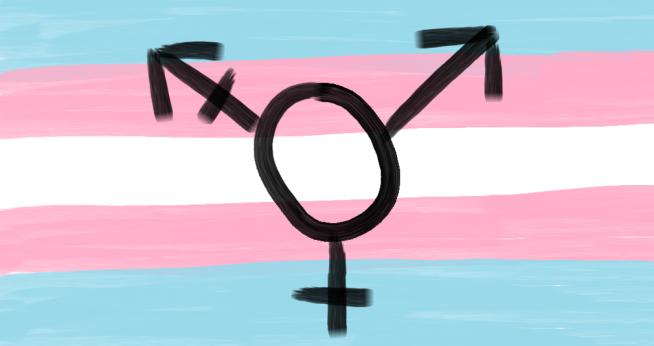Weiterlesen Noch immer ist es im Profifußball der Männer ein Tabu, sich als schwul zu outen. Zurzeit gibt keinen einzige offen homosexuellen Fußballer im Profifußball der Männer. Deswegen haben Fußballer*innen aus ganz Deutschland nun eine Aktion ins Leben gerufen: Unter dem Hashtag #ihrkönntaufunszählen und einer Erklärung, die im Fußballmagazin 11 Freunde veröffentlicht wurde, sicherten sie homosexuellen Spieler*innen ihre Unterstützung zu. „Wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen. Denn ihr tut das Richtige, und wir sind auf eurer Seite", heißt es in dem Solidaritätsschreiben. Zu den Unterzeichner*innen des Aufrufes gehören unter anderen Profis wie Max Kruse (1. FC Union Berlin), Niklas Stark (Hertha BSC), Bakery Jatta (Hamburger SV), die Nationalspielerinnen Almuth Schult und Alexandra Popp (VfL Wolfsburg). Auch ganze Mannschaften wie zum Beispiel der 1. FC Köln haben den Appell unterschrieben. Niemand solle zu einem Coming-out gedrängt werden, betonen die Unterzeichner*innen. Dies sei die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Denjenigen, die sich dafür entscheiden würden, wollen die Unterzeichner*innen ihre Solidarität zusichern. Es gehöre zu den elementaren Freiheitsrechten jedes Menschen gehört, sich zu seiner sexuellen Orientierung bekennen zu können. In den sozialen Medien wie Twitter wurde die Kampagne begeistert aufgenommen und verbreitet. Der DFB findet die Initiative eine „starke und wichtige Aktion“. Eine Userin kommentiert den Aufruf mit „Ob auf dem Platz, in der Fankurve oder in der Gesellschaft: was zählt ist Respekt, Akzeptanz & Vielfalt. Danke für diese wichtige Aktion @11Freunde_de die zeigt, wir dürfen nicht aufhören gegen Diskriminierung zu kämpfen und seid euch sicher #ihrkönntaufunszählen“.
LSBTIQ
Online-Gesundheitsberatung für schwule Männer
8. März 2021Weiterlesen Die Berater des Peer-to-Peer Projektes sind haupt- oder ehrenamtlich bei einer der Mitgliedsorganisationen der Deutschen Aidshilfe aktiv und sind in Fragen zu sexueller Gesundheit, sexuell übertragbaren Infektionen und HIV/AIDS ausgebildet. Dabei sind sie für die Beratung im Internet geschult, kennen sich mit schwulen Lebenswelten aus und bieten die Beratung natürlich vertraulich und anonym an. Alle Chat-Nachrichten sind außerdem „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“. Die Beratung findet täglich von 17-20 Uhr statt. Das Angebot soll jedoch keine medizinische Beratung leisten oder eine Therapie ersetzen.
Weiterlesen Die Autor*innen Göth und Kohn unterscheiden in ihrem Buch „sexuelle Orientierung“ zwischen sexuellem Verhalten, sexueller Orientierung und sexueller Identität. Denn es handelt sich hier um unterschiedliche Aspekte von Sexualität und Geschlechtlichkeit, die nicht immer kongruent sind. Die sexuelle Orientierung verstehen sie als die „die Ausrichtung der sexuellen und emotionalen Bedürfnisse eines Menschen auf andere Menschen des gleichen oder des anderen Geschlechts oder auf beide Geschlechter“. So können dann zum Beispiel sexuelles Verhalten und sexuelle Orientierung unterschieden werden. Manche Menschen machen im Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit dem Geschlecht, welches sie in ihrer Orientierung eigentlich nicht bevorzugen, ohne dass sich diese dadurch ändert. Und Menschen sind natürlich auch dann zum Beispiel homo- oder heterosexuell, wenn sie gerade nicht sexuell aktiv sind. Die sexuelle Identität schließlich ist ein umfassenderer Begriff, und bezieht das Leben als hetero-, homo- oder bisexueller Mensch mit ein, und welche Selbstbezeichnungen die Menschen dafür wählen. Also ob sie sich zum Beispiel als „queer“, „schwul“ oder „lesbisch“ verstehen und was dies für sie bedeutet. Die sexuelle Identität ist deswegen mehr als die sexuelle Orientierung. Die sexuelle Identität entwickelt sich zwar ausgehend von der sexuellen Orientierung, ist aber auch von dem jeweiligen kulturell-historischen Kontext und der eigenen gesellschaftlichen Situation bestimmt. Noch differenzierter wird das ganze in der Sexualforschung betrachtet, also etwa wenn Menschen zur ihrer Sexualität in Studien befragt werden. So klassifiziert das `Klein Sexual Orientation Grid` Sexualität in sexuelle Anziehung, Sexualverhalten, sexuelle Fantasien, emotionale Vorliebe, soziale Vorliebe, Lebensstil und Selbstidentifikation. Je nachdem, um welche Dimension es sich handelt, werden unterschiedliche Fragen gestellt. Bei sexueller Anziehung ist das zum Beispiel: „Zu wem fühlst du dich sexuell hingezogen?“. Bei der emotionalen Vorliebe wird gefragt: „Liebst du und magst du nur Angehörige des gleichen Geschlechts, nur des anderen Geschlechts oder Angehörige beider Geschlechter?“ Nicht mit der sexuellen Orientierung oder auch der sexuellen Identität zu verwechseln sind Intersexualität oder Transsexualität, welche sich auf körperliche (Intersexualität bzw. Intergeschlechtlichkeit) oder geschlechtsidentitätsbezogene Aspekte (Transsexualität bzw. Transgeschlechtlichkeit) beziehen.
Weiterlesen 1919 gründete er das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. Es fungierte zugleich als eine Art Beratungsstelle für Menschen, die Fragen zu ihrer Sexualität hatten. Das Institut organisiert 1921 die “Erste internationale Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage”. Auf diesem internationalen Kongress waren namhafte Wissenschaftler*innen und Sexualreformer*innen vertreten. Hirschfelds damalige Theorien zu Homosexualität muten heute sonderbar und an. So meinte er, körperliche Unterschiede zwischen homo- und heterosexuellen Männern feststellen zu können. Auch in der Handschrift würden sich Unterschiede zeigen. Hirschfeld befasste sich auch wissenschaftlich mit (damals noch nicht unter diesen Begriffen bekannten) Phänomenen wie Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Er und seine Institutsmitglieder setzten sich außerdem dafür ein, dass sog. "Transvestitenscheine" eingeführt und polizeilich anerkannt wurden. In diesen Bescheinigungen wurde festgehalten, dass die betreffende Frau als "Männerkleidung tragend" bzw. der betreffende Mann als "Frauenkleidung tragend" bekannt ist, was ansonsten nicht erlaubt war. 1933 wurden das Institut und seine Bibliothek inklusive Schriften Hirschfelds im Zuge der Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten zerstört. Als Jude, Sozialist und schwuler Mann war Hirschfeld von nationalsozialistischer Verfolgung betroffen. Er flüchtet ins Exil nach Frankreich und verstirbt dort im Jahre 1935. Heute die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft dafür ein, sein wissenschaftliches und kulturelles Erbe und seines Instituts für Sexualwissenschaft zu erforschen und zu bewahren. Eine Online-Ausstellung informiert mit zahlreichen Originaldokumenten über die Geschichte des Institutes.
Weiterlesen Dazu gehört eine Veränderung der konservativen Sexualmoral, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche, sowie die Akzeptanz von sexuellen Minderheiten. "Die Kirche braucht einen neuen und positiven Zugang zur Sexualität, ihrer bewussten Gestaltung und der Tatsache, dass Sexualität zum Leben gehört“, so die Reformer*innen. Heterosexuelle, Lesben, Schwule, trans- und intergeschlechtliche Menschen – alle gehörten selbstverständlich zur Kirche. Hier dürfe es keine Verurteilungen und Diskriminierungen mehr geben. In Anbetracht der steigenden Kirchenaustrittszahlen stellen die Akteur*innen abschließend die mahnende Frage an die Bischöfe: "Welche Zukunft hat die Kirche ohne Gläubige?" Das Bündnis appelliert eindringlich: "Verspielen Sie die letzte Chance nicht!" In der Tradition Luthers schlugen außerdem Aktivist*innen der Reformbewegung Maria 2.0 Thesenpapiere an die Türen von Kirchen. In dem Papier mit sieben Thesen fordern sie unter anderem den Zugang für Frauen zu allen Ämtern, die Abkehr vom Klerikalismus und damit verbundenen Machtstrukturen sowie die Abschaffung des Zölibats.
Kieler Staatskanzlei stellt Referenten wegen homofeindlicher und sexistischer Äußerungen frei
3. März 2021Weiterlesen Der nicht namentlich genannte Referent hatte zuvor einen Artikel über das „Spenden-Dinner“ von Gesundheitsminister Spahn auf Facebook gepostet und ihm sowie Kanzlerin Merkel Versagen in der Coronakrise vorgeworfen. Später kommentierte er diesen Beitrag mit "Frauen kann man hier nichts in die Hand geben, Schwulen auch nicht. Wir bräuchten in dieser Situation Männer wie Helmut Kohl und Helmut Schmidt." Laut den "Kieler Nachrichten" regierte Ministerpräsident Günther auf den Vorfall "ungewöhnlich wütend". "Die in Rede stehenden Äußerungen sind unter keinerlei Umständen akzeptabel", so zitieren die Kieler Nachrichten Günther.
Weiterlesen Wie aus einer Auswertung der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, wurden zwischen 2005 und 2016 im Schnitt jährlich 1871 „normangleichende“ Operationen an unter 10-Jährigen in Deutschland verzeichnet. Doch obwohl inter* Menschen in Deutschland (und weltweit) schon seit Jahren das Verbot unfreiwilliger Eingriffe im Kindesalter fordern, und im schwarz-roten Koalitionsvertrag ein Gesetzeserlass noch in dieser Legislaturperiode vorgesehen ist, ist seit über einem Jahr kein Fortschritt des Gesetzes bekannt gegeben worden – trotz der Wichtigkeit eines gesetzlichen Verbots. Wie Grünen Queer-Politik-Sprecher Sven Lehmann kommentiert, können unfreiwillige Genitaloperationen für viele Menschen Leid verursachen. So auch für den inter* geborenen Christian, der heute als Mann lebt, dessen äußerliche Geschlechtsmerkmale jedoch mit einem Jahr operativ „feminisiert“ wurden, und dessen Arzt seinen Eltern empfahl, ihn als Mädchen zu erziehen. Er selbst erfuhr erst mit elf Jahren von seinen Eltern, dass er inter* geboren worden war. Doch auch dann blieb es für Freund*innen und Familie ein „Tabu-Thema“: „Eigentlich gibt es uns gar nicht für die Gesellschaft. Wir sind so gesehen unsichtbar. Viele wissen auch gar nicht, was das ist“, schildert Christian der Deutschen Welle in einer Kurz-Reportage – obwohl in Deutschland etwa 160.000 Menschen inter* sind und fast jeden Tag ein inter* Kind geboren wird. Deren Eltern wird oft empfohlen ihr Kind entweder als Mädchen oder Jungen zu erziehen, wie auch bei Christian, der unter dem ihm auferlegten und an-operierten Geschlecht in der Jugend sehr litt. Als erwachsener Mann konfrontierte er die Chirurgin, die ihn als Säugling operiert hatte – eine Operation, die Grund dafür ist, dass er heute nicht, wie er sich eigentlich wünscht, Kinder wird zeugen können. Dass die Chirurgin sich laut Christian zwar bei ihm entschuldigte, dabei aber „kühl und distanziert“ blieb, unterstreicht die Notwendigkeit eines Gesetzes deutlich. Nicht nur für das Verbot „normangleichender“ Eingriffe an Kindern, sondern, wie Sven Lehmann fordert, auch der Auflegung eines Fonds für die Entschädigung intergeschlechtlicher Menschen, „die unter den Folgen von nicht medizinisch indizierten geschlechtsangleichenden oder -verändernden Operationen leiden“.
Weiterlesen Die Beschlüsse beinhalten beispielsweise Resolutionen gegen eine vermeintliche „LGBT-Ideologie“, die laut Duda für die Menschheit „destruktiv“ sei, und eine „Familien-Charta“, in der er sich unter anderem verpflichtete die Ehe als „Verbindung aus Mann und Frau“ zu „schützen“ und keine Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare zuzulassen. Dass die Kommunen dabei mitgegangen seien widerspreche, so Boff, der entscheidenden Rolle, die die Gebietskörperschaften bei der Verteidigung der Bürgerrechte, der Förderung des Dialogs, und des sozialen Zusammenhalts spielen sollten. Positiv sei, dass die Erklärungen nicht von allen Kommunen verabschiedet und von manchen explizit abgelehnt worden waren. Dass LSBTIQ-Aktivist*innen auf Basis dieser drei Kriterien– verabschiedet (rot), noch nicht verabschiedet (gelb), und abgelehnt (grün) – einen „Atlas des Hasses“ erstellt haben zeigt jedoch nicht nur, dass der Großteil des Landes für LSBTIQ eine „rote Zone“ ist, sondern auch, dass diese Zonen für queere Menschen so gefährlich sind, dass sie einen Atlas benötigen, um sie zu vermeiden. Dies allein unterstreicht die Notwendigkeit des Berichtes, der dem „Ausschuss für aktuelle Angelegenheiten“ des Europarat-Kongresses der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften vorgelegt wurde: Wie Queer.de berichtet soll dem Kongress auf seiner Grundlage „bis zum Sommer eine Entschließung vorgelegt werden, in der die polnischen Behörden aufgefordert werden, ihre Erklärungen zurückzuziehen und Richtlinien zu entwickeln, um die Rechte schutzbedürftiger Gruppen zu garantieren“. Neben dem Europarat (der kein Organ der EU ist) hatte auch die Europäische Union mit Förderungsstopps reagiert, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte deutlich: „LGBTQI-freie Zonen sind Zonen, die frei von Menschlichkeit sind. Sie haben keinen Platz in unserer Union“. Darüber hinaus stellte die EU im November 2020 eine Strategie zum Schutz von LGBTI vor. Auch der LSVD zeigt „viele Möglichkeiten, was Politik, Zivilgesellschaft und Community tun können, um den Hass zu stoppen und LSBTI zu verteidigen“ auf – finden Sie hier zahlreiche Informationen zu der Situation in Polen und dazu, wie Sie aktiv werden können.
Weiterlesen Durch eine exekutive Anordnung Bidens wurde das von Donald Trump im Jahr 2018 erlassene Verbot aufgehoben. Eine der offiziellen Begründungen für die hoch umstrittene Anordnung Trumps lautete damals, trans* Soldat*innen hätten spezielle medizinische Bedürfnisse, und seien daher eine finanzielle und logistische Belastung für das Verteidigungsministerium. Zuvor war es unter der Regierung Obamas, Trumps Vorgänger, zu einer Inklusion von trans* Menschen in die Streitkräfte gekommen. Transgeschlechtlichen Menschen war es erlaubt, im Militär zu dienen, ohne ihre Identität verbergen zu müssen. Das weiße Haus erklärte nach der Aufhebung des Verbotes: „Präsident Biden ist davon überzeugt, dass die Geschlechtsidentität kein Hindernis für den Militärdienst sein sollte und dass Amerikas Stärke in seiner Vielfalt liegt". Zuvor hatte sich bereits der neue Verteidigungsminister, Austin, dafür ausgesprochen, das Verbot zu kippen. "Wenn man fit und qualifiziert ist, um zu dienen, sollte man dienen dürfen", sagte Austin.
Was ist eigentlich ein „Ally“ – und wie kann ich einer sein?
27. Februar 2021Weiterlesen Für die LSBTIQ* Community ist ein Ally eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person, die queere Menschen unterstützt und sich für ihre Rechte und Anliegen einsetzt. Hier gibt es jedoch kein allgemeingültiges Regelwerk: Ein Ally muss sich bilden, einsetzen, handeln, und aus Fehlern lernen können. Wie Expert*innen dem Oprah-Magazin mitteilten gibt es dabei jedoch Richtlinien, die dabei helfen können, ein guter Ally zu sein. Das erste ist dabei die Anerkennung des eigenen Privilegs und dessen Einsatz zum Guten. Dieses äußert sich beispielsweise schon darin, dass eine cisgeschlechtliche Person keine Sorge haben muss, am Arbeitsplatz für ihre Geschlechtsidentität angegriffen zu werden – während das Nationale Zentrum für transgeschlechtliche Gerechtigkeit in den USA fand, dass dort über drei Viertel von trans Menschen Diskriminierung erfahren. In Deutschland erleben laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes 67,4 Prozent – fast drei Viertel – soziale Herabwürdigung. Dagegen kann sich ein Ally einsetzen, indem sie/er Menschen korrigiert, wenn sie trans Kolleg*innen mit den falschen Pronomen ansprechen („misgendern“) – auch, wenn die betroffene Person gar nicht da ist. Außerdem sollte sich ein Ally immer gegen Beleidigungen oder queer-feindliche Witze aussprechen. Nicht nur in konfrontativen Situationen jedoch kann Allyship (Engl.: „Verbundenheit“) geübt werden: Wer in ihrer/seiner E-Mail-Signatur Pronomen angibt, de-stigmatisiert auch die Pronomens-Angabe für trans oder nicht-binäre Personen. Und wer sich dabei unsicher über die (Hinter-)Gründe dieser Themen ist, sollte sich als Ally selbst fortbilden, recherchieren, lesen, und zuhören, und erst dann informierte Fragen stellen – anstatt die Erwartung zu haben, alles von queeren Menschen erklärt zu bekommen. Umso offener man bei dem Stellen informierter Fragen ist, desto leichter wird es zu lernen und effektiv zu kommunizieren, so Menschenrechtsaktivistin Maybe Burke: „Lass Leute von Anfang an wissen, dass Du für Anleitung und Feedback offen bist“. Wie der schwule Journalist Carlos Maza in seiner Anleitung schreibt: Als Ally sollte man den queeren Menschen im eigenen Umfeld zuhören, sie fragen, wie es ihnen geht, und sich dabei bewusst machen, dass sie potentiell Dinge durchgemacht haben (oder noch immer durchmachen), die für eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person unvorstellbar sind – und dabei Unterstützung anbieten wo es geht, ohne sich in die Rolle des „Retters“ zu begeben. Der Weg zur Gerechtigkeit muss gemeinsam gegangen werden, und nicht-queere Menschen tragen dabei die gleiche Verantwortung wie LSBTIQ* - nur wer dies spürt und sich über das eigene Handeln nicht profiliert kann ein wahrer Ally sein.