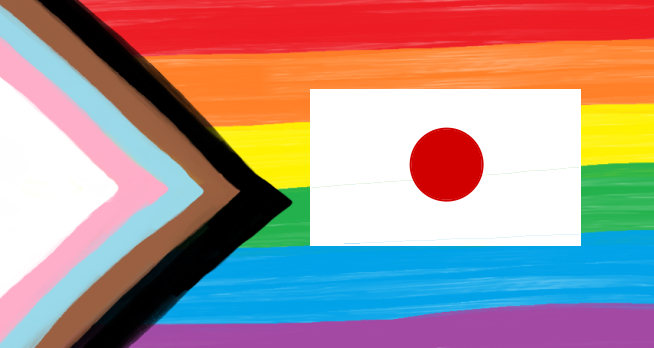Die Aufarbeitung der Geschichte queerer Verfolgter im Nationalsozialismus weist noch Lücken auf, wie Historiker*innen und queere Verbände kritisieren.
Weiterlesen
Der LSVD
forderte schon vor einigen Jahren mehr Forschung zur Verfolgung von Lesben sowie trans, inter und anderen queeren Personen unter dem deutschen Faschismus. Erst 2022
erinnerte der Deutsche Bundestag erstmals am internationalen Holocaust-Gedenktag offiziell auch an die queeren Verfolgten des NS-Regimes. Dieser Beitrag soll eine (unvollständige) Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zu insbesondere weiblichen queeren Verfolgten des Nationalsozialismus liefern.
Denn vor allem die Geschichten queerer Frauen im Holocaust haben in der deutschen Erinnerungskultur noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, wie einige Historiker*innen betonen. Diese Unsichtbarkeit spiegelt sich in der historischen Aufarbeitung um Homosexualität und Nationalsozialismus wieder, in der Frauen oft marginal bleiben, so
Sébastian Tremblay: „Da sich der Großteil der Erinnerungspolitik auf den §175 StGB und die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Begehren und Sexualitäten in der Vergangenheit konzentrierte, erlaubte das Fehlen eines solchen ‚gespenstischen‘ Abschnitts des Strafgesetzbuchs für queere weibliche Sexualitäten queeren (meist) männlichen Historikern, neue Formen des Erinnerungsaktivismus zurückzuweisen.“
Die Historiker*innen Claudia Schoppenmann und Christian-Alexander Wäldner weisen im Portal „
Lesbengeschichte“ ebenfalls auf die systematische Unsichtbarkeit lesbischer Frauen in den Archiven hin, was mitunter aus einer anhaltenden Tabuisierung weiblicher Homosexualität rühren könnte. Dennoch scheint sich in den letzten Jahrzehnten etwas in der Forschung getan zu haben:
Wichtige Beiträge zur Erforschung der Verfolgung von lesbischen und anderen queeren Frauen im Holocaust lieferte Schoppmann u.a. mit ihrem Buch „Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität“ von 1997 (
Springer Verlag).
Eine weitere Vorreiterin in dem Forschungsfeld ist die Holocausthistorikerin Anna Hájková, die neben ihrer eigenen wichtigen Forschung
[1] im Rahmen des Projekts „Sexuality and Holocaust“ eine
Literaturliste mit Beiträgen zusammengestellt hat, die die Verfolgung von lesbischen und trans Frauen in der NS-Zeit erforschen. Die bereits veröffentlichten Werke sollen Anstöße dazu liefern, dass weiter zu dem Thema geforscht wird. Denn es wird gleichzeitig auf die Lücken hingewiesen, die es insbesondere im deutschsprachigen akademischen Diskurs zum Thema gibt.
Unter die gelisteten Publikationen fallen diverse Beitragsformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: von biographischen Spurensuchen
[2] zu Analysen der medizinischen, rechtlichen und politischen Diskurse um homosexuelle Frauen und die damit einhergehende Stereotypisierung weiblicher Homosexualität
[3]. Die deutschsprachige Forschung zu trans Frauen in der NS-Zeit scheint noch weniger vorangeschritten zu sein, dennoch bieten Beiträge wie u.a. von Ingeborg Boxhammer und Christiane Leidinger
[4] wichtige Perspektiven, um dieses Thema weiter zu ergründen. Das Projekt „Sexuality and Holocaust“ ruft auch dazu auf, weitere Beiträge zum Forschungsfeld, die noch nicht in der Literaturliste aufgenommen sind, zu ergänzen. Solche öffentlichen und kollektiven Projekte sind wichtig, um ein möglichst breites Wissen um die Situation lesbischer, trans, inter und anderer queerer Frauen unter den Schrecken des Nationalsozialismus zu sammeln und zu verbreiten.
[1] Um nur wenige zu nennen:
Queere Geschichte und der Holocaust. In: APuZ, 38–39, 2018, S. 42-47;
Menschen ohne Geschichte sind Staub, Wallstein Verlag, 2024. In München veranstaltet das Forum Queeres Archiv gemeinsam mit dem Buchladen Rauch & König am 27.06.2024 eine Lesung mit Anna Hájková zuihrem Buch „Menschen ohne Geschichte sind Staub“, das erst kürzlich in zweiter erweiterter Ausgabe erschienen ist. Zur
Veranstaltung.
[2] Tamara Breitbach:
Lea Gertrud Schloß – Jüdin, Lesbe, Schriftstellerin und Sozialdemokratin: Biografischer Essay. In: Gertrud Schloß: Die Nacht des Eisens: Gedichte, Éditions trèves, 2019, S. 41-87.
[3] Brunner, Andreas & Sulzenbacher, Hannes:
Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien. Mandelbaum Verlag, 2023.
[4] Sexismus, Heteronormativität und (staatliche) Öffentlichkeit im Nationalsozialismus. Eine queer-feministische Perspektive auf die Verfolgung von Lesben und/oder Trans* in (straf-)rechtlichen Kontexten, in Michael Schwartz: Homosexuelle im Nationalsozialismus: Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, De Gruyter, 2014.