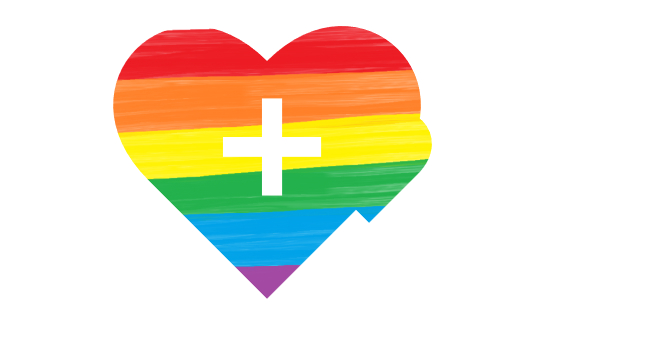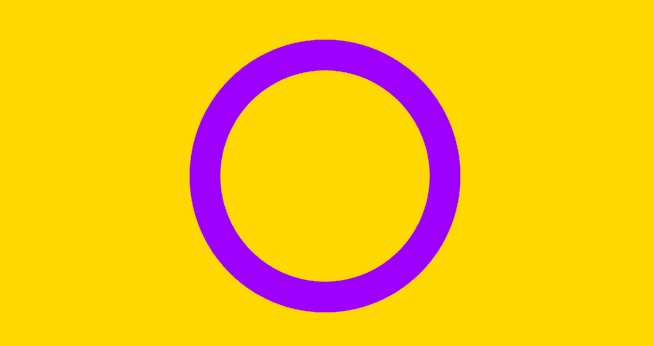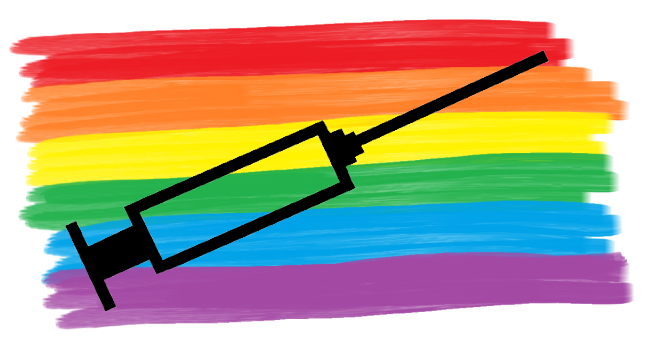Sexualität im Alter bei schwulen Männern
28. April 2021Weiterlesen Über die sexuellen Bedürfnisse schwuler Männer gäbe es nur wenige Forschungsdaten so Gerlach und Szillat am Anfang ihres Essays. Es scheine zudem, als ob die Tabuisierung des Themas Sexualität im Alter auch bei schwulen Männern fortwirke, gleichzeitig fänden aber auch Emanzipationsbemühungen statt. Die Autoren beginnen mit einer Darstellung des Themenkomplexes „Sexualität im Alter“. Entgegen bestehender Vorurteile ist Sexualität im Alter nicht unbedingt rückläufig und ihr kann ein hoher Stellenwert zu kommen. Die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr und die Intensität von sexuellem Verlangen nimmt zwar ab, aber das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Zuneigung bleibt. Körperliche Alterungsprozesse und der Gesundheitszustand einer Person haben Einfluss auf das sexuelle Verhalten und auf das Erleben von Sexualität. Die Biografien schwuler Senioren sind durch staatliche Verfolgung und gesellschaftliche Stigmatisierungen und Diskriminierungen geprägt. Einige, so die Autoren, hätten einen offenen Umgang mit ihrer schwulen Identität und finden auch im Alter Wege, ihre sexuellen Bedürfnisse umzusetzen bzw. an veränderte Bedingungen anzupassen. Andere, die bisher einen verschlossenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität gelebt haben, verinnerlichen eher Vorstellungen von einer defizitären Alterssexualität. Gesundheitsbedingte sexuelle Probleme und Dysfunktionen können Identitätskrisen auslösen. Auch Attraktivitätsnormen der schwulen Szene können sich auf das Selbstbild älterer schwuler Männer auswirken. Einige schwule Männer versuchen den altersbedingten körperlichen Veränderungen durch bestimmte Maßnahmen entgegenzuwirken. Anderen gelänge es eher, ein Altersselbstbild aufzubauen, in welchem körperlichen Veränderungen gelassener entgegengesehen werde, schreiben Gerlach und Szillat. Alternative Beziehungsmodelle als das der monogamen Zweierbeziehung werden bei schwulen Senioren häufiger gelebt als bei heterosexuellen älteren Menschen. So öffnen zum Beispiel schwule Paare mit der Dauer ihrer Partnerschaft diese eher für Sexualkontakte außerhalb der Beziehung. Gerlach und Szillat gehen im Weiteren auf die verschiedenen Umgänge pflegebedürftiger schwuler Senioren mit ihrer Sexualität ein. Diese unterscheiden sich teilweise je nach Persönlichkeit und Biografie deutlich voneinander. Zum Ende des Essays konstatieren die beiden, dass die Gesellschaft in Sachen der Alterssexualität zwar grundsätzlich liberaler geworden sei. Dennoch fehlten vor allem bei Beratungsstellen oder in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine akzeptierende und respektvolle Haltung gegenüber sexuellen Wünschen und Problemen im Alter. Es besteht auf jeden Fall noch weiterer Forschungsbedarf. Um mehr über die sexuellen Bedürfnisse und Wünsche von älteren schwulen Männern zu erfahren, sei es notwendig, diese Altersgruppen in allgemeinen Studien miteinzubeziehen oder auch eigene Erhebungen durchzuführen, konstatieren die Autoren.