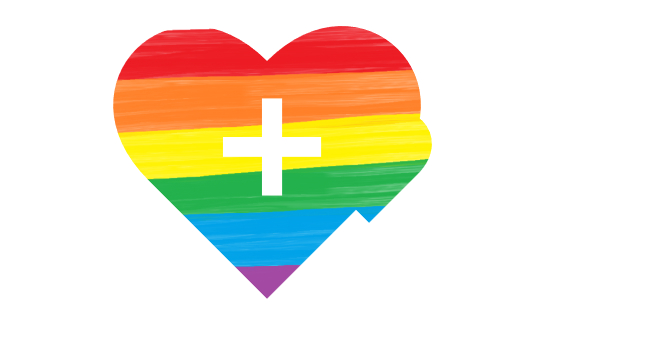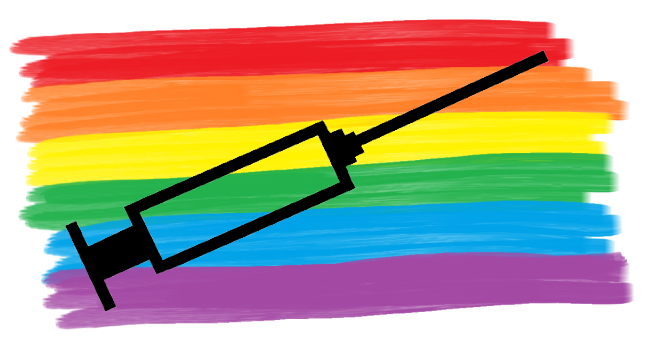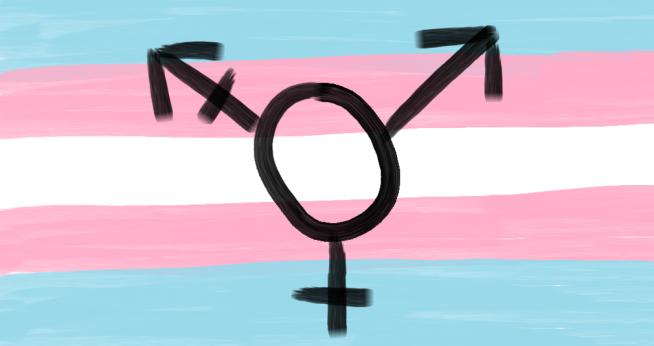Weiterlesen So sind trans Personen in Deutschland noch immer gezwungen, sich einer langen und teuren „Begutachtung“ auszusetzen, um ihr legales Geschlecht zu verändern. Dieser Prozess sei, so die trans Aktivistin Felicia Rolletschke, „degradierend, teuer, und unlogisch“. Dem neuen Ampel-Koalitionsvertrag zufolge würde eine Reform bedeuten, dass trans Personen in Deutschland ihr eigenes Geschlecht mit weniger dieser Hürden bestimmen könnten. So wolle die Koalition erreichen, dass die gesetzliche Krankenversicherung die medizinische Versorgung im Zusammenhang mit einer geschlechtsangleichenden Transition in vollem Umfang übernimmt. Demzufolge müsste es dann beispielsweise nicht mehr zu Verfahren wie vor einigen Wochen kommen, bei der eine trans Frau vor Gericht klagen und ihren Hals entblößen musste, um eine operative Reduktion ihres Adamsapfels von der Kasse übernommen zu kommen. Es werde zudem ein Entschädigungsfonds für trans und inter Personen eingerichtet, die durch frühere Gesetze geschädigt wurden, zum Beispiel durch Zwangssterilisationen oder unnötige Operationen. Bis 2011 waren trans Menschen in Deutschland gezwungen, sich einer Zwangssterilisation zu unterziehen, um eine rechtliche Geschlechtsanerkennung zu erhalten. Und Anfang diesen Jahres wurde in Deutschland zwar ein gesetzliches Verbot sogenannter „normalisierender“ Operationen an intersexuellen Kindern und Jugendlichen erlassen, doch bei vielen wirke das Trauma der unnötigen Eingriffe noch immer nach. So veröffentlichte der Deutsche Ethikrat im Jahr 2012 einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass „viele Menschen, die in ihrer Kindheit einer 'normalisierenden' Operation unterzogen wurden, diese später als Verstümmelung empfunden haben und ihr als Erwachsene niemals zugestimmt hätten“. Mit einem solchen Entschädigungsfonds wäre Deutschland das zweite Land der Welt, das trans Personen für Zwangssterilisationen entschädigt, nachdem Schweden 2018 das erste war. Nun fragen sich wohl gegenwärtig viele trans und inter Personen wann mit dem versprochenen Gesetz gerechnet werden könne. Darüber sprach Freddy Mo Wenner, eine Person die drei Jahre im Bundestag gearbeitet hat und sich mit trans Themen gut auskennt, in einem Interview mit queer.de. Auf die Frage, wann das Gesetz denn komme, sagte Wenner: „Der Referent*innenentwurf kann theoretisch in ein bis drei Monaten erarbeitet sein. Mit der Anhörung der Verbände und der Runde durch den Bundesrat sind wir bei insgesamt vier bis sechs Monaten – wenn alles gut und glatt läuft. Was aber immer sein kann, ist, dass im Kabinett Uneinigkeit herrscht, zum Beispiel, weil ein anderes Ressort einhakt. Dann wird es dort erst weiter politisch diskutiert, bevor es weitergeschoben wird.“ Trotz fortschrittlicher Projekte für die Rechte von queeren Menschen im Koalitionsvertrag und diesem „Meilenstein“, wie Julia Monro, von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (DGTI), dies bezeichnet, gilt es also hoffen, dass sich die Ampel nicht nur an die Versprechen ihres Koalitionsvertrages hält, sondern diese auch möglichst schnell erfüllt.
Gesundheit
Weiterlesen Daniel Wesener, ein schwuler Grüner wird Berliner Finanzsenator und der schwule Aktivist und QueerGrün-Chef Pascal Haggenmüller ist zum Parteivorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg gewählt worden. Die Koalition fordert, den Schutz queerer Menschen im Grundgesetz zu verankern. Auf Initiative von Berlin und Hamburg empfiehlt die Innenministerkonferenz ein härteres Vorgehen gegen queerfeindliche Gewalt. So sollen in einem unabhängigen Sachverständigengremium Vertreter*innen der Wissenschaft und Sicherheitsbehörden gemeinsam mit Fachverständigen aus der queeren Community konkrete Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung queerfeindlicher Gewalt und für die Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden erarbeiten. Außerdem plant die Koalition, das Verfahren zu ändern, mit dem trans Personen in Deutschland rechtlich anerkannt werden, und die geschlechtliche Selbstidentifizierung einzuführen. Zu den weiteren Reformvorschlägen gehören die Verschärfung des Verbots von sogenannten „Konversionstherapien“ in Deutschland, die bundesweite Erfassung von Hassverbrechen gegen LGBTQI*, die Abschaffung von Beschränkungen bei der Blutspende für Männer, die mit Männern schlafen, die Überprüfung von Asylverfahren für queere Asylsuchende und das automatische Elternrecht für die Ehefrauen lesbischer Mütter, die das leibliche Kind ihrer Partnerin derzeit noch adoptieren müssen, um offiziell als zweite Mutter zu gelten. Julia Monro, von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (DGTI), sagte dem Tagesspiegel: „Noch nie gab es in einem Koalitionsvertrag so fortschrittliche Projekte für die Rechte von queeren Menschen. Das ist ein Meilenstein und die queere Community jubelt.“ Nun gilt es abzuwarten und zu hoffen, dass sich die Ampel an die Versprechen ihres Koalitionsvertrages hält.
Urteil: Trans Frau hat Anspruch auf Reduktion des Adamsapfels
29. November 2021Weiterlesen Demzufolge sei eine Kehlkopfreduktion nicht erforderlich gewesen, um eine weitere Annäherung an das "weibliche Erscheinungsbild" zu erreichen, sondern es handle sich dabei lediglich um eine Schönheitsfrage. Dafür müsse die Krankenkasse nicht aufkommen. Doch der Kehlkopf der Klägerin sorgte regelmäßig für Irritationen, weil sie deshalb von anderen Menschen dem männlichen Geschlecht zugeschrieben wurde. Wie sie queer.de anonym erzählte, habe sie das schwer belastet und sogar depressive Phasen ausgelöst, weil ihr so immer wieder vor Augen geführt worden sei, dass sie von der Gesellschaft nicht als Frau wahrgenommen wurde. Als sie also Widerspruch gegen die Ablehnung der Kostenübernahme einlegte, sei sie zur Begutachtung einbestellt worden. Dort habe sich der Gutachter geweigert, sie als Frau anzusprechen, und ihr gesagt, dass sie eine Psychotherapie machen solle, wenn sie Probleme mit ihrem Kehlkopf habe. Gegen diese Zurückweisung des Widerspruchs reichte die Frau schließlich Klage ein. Dies führte schließlich zu einem Berufungsverfahren am Landessozialgericht in Mainz, bei dem sie gebeten wurde, aufzustehen und ihren Schal abzulegen, so dass sich alle im Saal einen persönlichen Eindruck von ihrem Hals verschaffen konnten. Anschließend zog sich der Senat zur Beratung zurück und verkündete danach, dass er der Ansicht sei, dass der Adamsapfel der trans Frau deutlich einem "männlichen Erscheinungsbild" entspreche. Der Vertretung der Krankenkasse wurde deswegen die Möglichkeit gegeben, ihre Argumentation zu überdenken, diese blieb jedoch bei ihrer Position. So fällte das Gericht schließlich sein Urteil und gab der Klägerin Recht. Die Inaugenscheinnahme ihres Halses durch den gesamten Gerichtssaal ging der Klägerin jedoch sichtlich sehr nahe. Der Vorsitzende Richter entschuldigte sich zwar für die Begutachtungsprozedur mit den Worten "Ich kann mir vorstellen, dass sich das entwürdigend anfühlen muss", langfristig kann es jedoch wohl keine Lösung sein, dass trans Personen sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Transitionsphase bei jeder beantragten medizinischen Maßnahme einem oft entwürdigenden Begutachtungsprozess unterwerfen müssen. Dazu erklärte Rechtsanwältin Katrin Niedenthal, die Prozessvertreterin der Klägerin in der zweiten Instanz, gegenüber queer.de: "Gerade wenn als Anspruchsvoraussetzung das äußere Erscheinungsbild einer Person bewertet werden soll oder – wie hier – eine Annäherung an ein 'weibliches' oder 'männliches' Erscheinungsbild, stellt sich die Frage, wie das objektiv überhaupt funktionieren soll". Petra Weitzel, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti), erklärte deswegen: "Geschlechtsangleichende Maßnahmen dürfen nicht der Willkür subjektiver Bewertungen unterliegen, die ihnen als vermeintlich objektiv vermittelt werden, sondern müssen einheitlich im Gesetz festgeschrieben sein."
Urteil des Bundessozialgerichts: Lesbische Paare müssen Kinderwunschbehandlung selbst finanzieren
24. November 2021Weiterlesen Wie queer.de berichtete hatte im konkreten Fall eine lesbische und unfruchtbare Klägerin die Kostenerstattung einer Kinderwunschbehandlung verlangt, wurde jedoch von der Hanseatischen Krankenkasse in Hamburg zurückgewiesen. Diese Entscheidung bekräftigte das Bayerische Landessozialgericht mit dem Argument, dass Voraussetzung für die Kostenerstattung sei, dass für die Behandlung Ei- und Samenzellen des Ehepartners verwendet werden. Die Notwendigkeit bei einer gleichgeschlechtlichen Ehe Spendersamen eines Dritten zu verwenden sei dabei von der gesetzlichen Regelung nicht umfasst – auch nicht bei heterosexuellen unfruchtbaren Ehepaaren. Gerechtfertigt wird diese Unterscheidung mit Kindeswohl, da ein Kind bei künstlicher Befruchtung durch eine Person, die mit der dann Schwangeren verheiratet ist, automatisch zwei zum Unterhalt verpflichtet Elternteile habe. Es sollten davon also nur Paare profitieren, die grundsätzlich zusammen Kinder bekommen können, denen dies aber durch eine "krankheitsähnliche Komponente" nicht gelingt, wodurch auch die Zuständigkeit der Krankenkassen überhaupt erst gerechtfertigt sei. Daraus folge aber nicht die Pflicht, die „zeugungsbiologischen Grenzen“ einer unfruchtbaren Ehe – ob hetero- oder homosexuell – „mit Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung auszugleichen", begründeten die Kasseler Richter*innen ihre Entscheidung. Nun hat die Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung (SPDqueer) am Donnerstag angesichts der BSG-Entscheidung eine Gesetzesnachbesserung für lesbische Frauen mit Kinderwunsch gefordert. Anfang Oktober hatte der Bundesvorstand der SPDqueer einen Antrag für den Bundesparteitag der SPD eingereicht, dessen Ziel eine bundeseinheitliche, gesetzliche Regelung hinsichtlich der Kostenübernahme für eine Kinderwunschbehandlung ist, die gleichermaßen für hetero- als auch gleichgeschlechtliche Paare gilt. Seit diesem Jahr fördern die Länder Rheinland-Pfalz und Berlin lesbische Paare mit Kinderwunsch bereits. Doch Co-Vorsitzende der SPDqueer Carola Ebhardt kritisierte, dass die Unterstützung beim Kinderwunsch nicht davon abhängen dürfe, in welchem Bundesland ein Paar lebt: „Daher braucht es eine bundeseinheitliche Regelung.“
Weiterlesen Dies erinnert auch in Deutschland an die noch bestehenden Paragrafen 218 und 219 des Strafgesetzbuches, die auch den Schwangeren hier den Zugang zu Abtreibungen erschweren, indem es für Ärzt*innen beispielsweise strafbar ist für das Angebot eines Abbruches zu „werben“. Darüber hinaus gilt die Beratung über einen Abbruch in erster Linie „dem Schutz des ungeborenen Lebens“, und nicht etwa der der schwangeren Person selbst. Und zusätzlich müssen „Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen [haben], daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen“ – eine Forderung die impliziert, dass schwangere Personen sich nicht ohnehin schon selbst Gedanken über den Schritt eines Abbruchs machen würden, und es dafür einen rechtlichen Rahmen brauche. Angesichts dieser Einschnitte in die reproduktiven Rechte werden Schwangerschaftsabbrüche im öffentlichen Diskurs häufig als „Frauenthema“ bezeichnet, welches in erster Linie heterosexuelle Frauen betrifft. Doch das Abtreibungsrecht hat auch weitreichende Folgen für LGBTQ+ Menschen – einschließlich nicht-binärer Menschen, trans Männern und queerer Frauen, die Zugang zu sich Abbrüchen benötigen. So können vielen queeren Menschen, die einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind, die Mittel fehlen, um eine Abtreibungsbehandlung in Anspruch zu nehmen, beispielsweise, wenn es sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, zu reisen, um reproduktive Gesundheitsversorgung zu erhalten. Außerdem sind LGBTQ+-Personen nicht nur häufiger nicht versichert, sondern sehen sich auch häufig mit Stigmatisierung und Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung konfrontiert, einschließlich Misgendering und aufdringlicher Fragen zu ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht. Und zusätzlich ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für viele queere Menschen, die in der Lage sind, schwanger zu werden, nicht nur ein entscheidender Bestandteil einer gerechten medizinischen Versorgung, sondern auch der sexuellen Gerechtigkeit: Queere Menschen sind häufiger von sexuellen Übergriffen betroffen. Wie Shayna Medley, eine US-Amerikanische Anwältin und Juristin es formuliert: „Reproduktive und LGBTQ+-Rechte sind damit untrennbar miteinander verbunden. Jeder verdient das Recht auf körperliche Autonomie, auf Gesundheitsversorgung und auf die Entscheidung, ob, wann und wie Kinder gezeugt werden sollen, ohne unangemessene Einmischung des Staates.“
Weiterlesen Der Forderungskatalog, der in ganzer Länge auf der Homepage des Vereins eingesehen werden kann, versammelt politische Maßnahmen zu den Bereichen des Vornamens und des Geschlechtseintrags, der Gesundheitsversorgung, Entschädigungszahlungen aufgrund von Grundrechtsverstößen und zum Diskriminierungsschutz. In ihrer Länge zeigt die Auflistung, dass bis zur Gleichstellung noch ein weiter Weg zu beschreiten ist. Noch regelt das Transsexuellengesetz, das nicht nur die dgti, sondern zahlreiche Abgeordnete wie Tessa Ganserer und Aktivist*innen abschaffen wollen, die Änderung des eingetragenen Namens und der Geschlechtseinträge. Nach einem neuen, offenen Geschlechtseintrag solle eine einfache Selbsterklärung auf einem Standesamt genügen, um diese Eintragungen korrigieren zu lassen. Außerdem fordert die dgti die Unterversorgung mit Gesundheitsleistungen für trans und inter Personen zu beenden und eine flächendeckende Versorgung zu erschaffen. So soll unter anderem der Anspruch auf geschlechtsangleichende Operationen für transgeschlechtliche, nichtbinäre und intergeschlechtliche Personen im Sozialgesetzbuch verankert werden, welcher auch für einwilligungsfähige Minderjährige gelten soll. Gegenwärtige sind nichtbinäre Menschen von der Kostenübernahme solcher Operationen generell ausgegrenzt, und auch sonst beruhen die Richtlinien und Begutachtungen vor einer Übernahme auf vielen diskriminierenden Fragen und Annahmen (echte-vielfalt.de berichtete). Für intergeschlechtliche Kinder fordert die dgti hingegen einen wirksameren Schutz gegen geschlechtszuweisende Operationen, bevor diese Kinder selbst entscheiden können. Für Menschen, die solche Eingriffe jedoch im Kindesalter hinter sich hätten, fordert die dgti Entschädigungszahlungen. Dasselbe wird gefordert für Personen, deren Ehe wegen des Transsexuellengesetztes annuliert worden ist. Für einen bessseren Diskriminierungsschutz fordert die dgti unter anderem einen nationalen Aktionsplan für die Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Weitere geforderte Maßnahmen, um Diskriminierung abzubauen sind unter anderem die gesonderte Erfassung von Straftaten wegen der geschlechtlichen Identität; die verpflichtende Einführung aller vier Personenstandseinträge (männlich, weiblich, divers, und nicht-binär) in Formularen staatlicher Institutionen; einen erweiterten Kündigungsschutz für Menschen im Transitionsprozess; und die Ausweitung des Rechts auf Abänderung von Dokumenten auf Heirats-, Geburts- und Abstammungsurkunden. Welche Chancen auf Umsetzung diese Forderungen bei der neuen Regierung, die sich gegenwärtig bildet, haben werden, wird sich erst zeigen, doch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte kurz vor den Wahlen zum Bundestag in der ZDF-Wahlsendung „Klartext“ die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes zugesagt. Nun gilt zu hoffen, dass er und seine Partei dies entsprechend den Vorstellungen und Forderungen Betroffener umsetzen werden.
Weiterlesen Wie das Unternehmen letzte Woche in der Datenbank für klinische Studien des National Institute of Health (NIH) bekannt gab, erprobt es seinen neuen mRNA-basierten Impfstoff nun am Menschen. Voraussichtlich soll die Studie, die am 19. August begann, im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Berichten zufolge entwickelt Moderna auch einen Grippeimpfstoff, der auf der gleichen Technologie basiert. Die Impfstoffe von Moderna haben Anfang des Jahres die Phase-I-Tests bestanden, bei denen er nur an einer Handvoll menschlicher Freiwilliger auf ihre Sicherheit geprüft wird. In Phase II wird die Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs getestet, und mit dem Übergang in Phase III wird Moderna die Wirksamkeit des Impfstoffs im Vergleich zu anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Präventionsbehandlungen, wie der Präexpositionsprophylaxe, auch bekannt als PreP, untersuchen. Seit den späten 1700er Jahren haben Forschende verschiedene Arten von Impfstoffen entwickelt, aber die meisten Impfstoffe für andere Viren haben sich als unwirksam gegen HIV erwiesen. Das Virus greift das Immunsystem selbst an und beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, andere Krankheiten und Infektionen zu bekämpfen. Anders als inaktive oder Lebendimpfstoffe enthalten mRNA-Impfstoffe keine Teile eines Virus. Stattdessen erzeugen sie Proteine, die selbst eine Immunreaktion im Körper auslösen. Auf diese Weise werden mehrere Nachteile anderer Impfstoffe beseitigt. Lebendimpfstoffe können verderben, wenn sie nicht kühl gelagert werden, was ein Problem für die weite Distribution darstellt, und gleichzeitig die Möglichkeiten der Hersteller zur Massenproduktion von Dosen einschränkt. Derzeit sind 16 HIV-Mutationen bekannt. Sollten neue impfstoffresistente HIV-Formen auftreten, könnten die Forscher die mRNA so bearbeiten, dass sie mit weit weniger genetischem Material als andere Impfstoffe leicht veränderte Proteine produziert. Obwohl es die mRNA-Impfstofftechnologie schon seit Jahrzehnten gibt, hat die lange Zulassungszeit bei der Food and Drug Administration (FDA) die Zahl der mRNA-Impfstoffe, die schließlich in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen, begrenzt. Die COVID-19-Pandemie änderte dies jedoch, da das letztjährige öffentlich-private Partnerschaftsprogramm „Operation Warp Speed“ den Zeitplan für klinische Impfstoffversuche und die FDA-Zulassung beschleunigte. „COVID-19 hat uns gezeigt, was wir tun können, wenn wir einen Impfstoff schnell auf den Weg bringen wollen“, sagte Dr. Andrew Pekosz, Virologe und Professor an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, gegenüber der Gesundheitsnachrichten-Website VeryWell. Sollte sich der HIV-mRNA-Impfstoff als wirksam erweisen, sagen Befürworter des Projekts, dass ein HIV-Impfstoff für die globale Gesundheit von entscheidender Bedeutung wäre. „Die einzige wirkliche Hoffnung, die wir haben, um die HIV/AIDS-Pandemie zu beenden, ist der Einsatz eines wirksamen HIV-Impfstoffs, der durch die Arbeit von Partnern, Befürwortern und Gemeindemitgliedern erreicht wird, die sich zusammentun, um gemeinsam das zu tun, was kein Einzelner oder eine Gruppe allein tun kann“, schrieb der Präsident der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), Dr. Mark Feinberg, im Juni in einer Erklärung zum 40-jährigen Jubiläum der HIV-Epidemie. Auch die Wissenschaftler von Moderna sind mit ihren Bemühungen nicht allein: Im Juli begannen an der Universität Oxford die Phase-I-Tests für einen „Mosaik“-Impfstoff. Beide könnten dazu beitragen, die Ausbreitung eines der heimtückischsten Viren der Welt im kommenden Jahrzehnt zu stoppen.
Weiterlesen Zwei Monate vor der Bundestagswahl hat Spahn (CDU) seine Errungenschaften für wegen ihrer sexuellen Identität diskriminierte Menschen herausgestellt. So bezeichnete er unter anderem das 2020 beschlossene Verbot der Konversionstherapie als wichtige „Weiche“. Außerdem schreibt er, dass auf Wirken seines Ministeriums die Blutspende-Voraussetzung für schwule Männer zwölf Monate enthaltsam gewesen zu sein aufgehoben werden würde, und weist in dem Dokument außerdem darauf hin, dass Menschen mit erhöhtem HIV-Infektionsrisiko seit September 2019 einen Anspruch auf Beratung, Untersuchung und Arzneimittel zur Vorsorge haben. Darüber hinaus listet das Dokument Projekte auf, mit denen die Stigmatisierung inter- und transgeschlechtlicher Menschen verringert werden soll. Diese „angeblichen Erfolge“ sind vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) jedoch als „Mogelpackung“ kritisiert worden, da sich Spahn für Maßnahmen feiere, die nicht auf seine Initiative hin, sondern „auf massiven Druck aus der Zivilgesellschaft entstanden“ sind. Außerdem bemängelte der Verband unter anderem, dass es weiterhin eine Ungleichbehandlung geben soll – denn anders als schwule Männer dürfen Frauen und heterosexuelle Männer auch bei wechselnden Sexualpartnern Blut spenden, doch dazu schwieg der Gesundheitsminister in dem Schreiben. Auch in Bezug auf das veraltete „Transsexuellengesetz“, welches seine Partei zu Beginn der letzten Legislaturperiode versprochen hatte zu reformieren, äußerte sich der Minister nicht, obwohl Aktivist*innen eine solche Reform längst fordern. Außerdem leiden Nichtbinäre seit Jahren unter „dem Hickhack“ bei der dritten Option des Geschlechtseintrags, wie Jeja Klein eine Woche nach Jens Spahns Selbstbeweihräucherung auf queer.de berichtet. Zwar bezieht sich Jeja gar nicht auf sein Schreiben, so beweist der Artikel jedoch, dass der Stand der geschlechtlichen Selbstbestimmung in Deutschland bei weitem nicht so erfolgreich vorangekommen ist, wie es der Gesundheitsminister darstellt. Tatsächlich bestehen unter der gegenwärtigen Gesetzeslage noch eine Vielzahl verschiedener Probleme, sowohl in Bezug auf das „Transsexuellengesetz“ als auch das Personenstandsgesetz, von denen Jeja anschaulich und ausführlich berichtet. Darin wird klar, dass noch ein weiter Weg vor der Bundesregierung liegt, bis sie auf ihre „Errungenschaften“ für die queere Community wirklich stolz sein und sich damit schmücken kann. Jeja schreibt: „Ich glaube, dass wir hoffen können. Aber es ist unklar, wie lange wir noch hoffen müssen und wie oft wir in dieser Zeit mit Enttäuschung umgehen werden. Bei der Ehe für alle ging alles ganz plötzlich, ganz schnell. Vielleicht wird es hier ja auch so? Wie bei den gleichen Rechten beim Heiraten dürfte den meisten Beobachter*innen klar sein: Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, wenigstens bei den amtlichen Einträgen, wird kommen“. Der Stand der Dinge kann sich bessern.
Weiterlesen “Wir sind hier, um über ein Gesetz abzustimmen, dem Freiheit, Gleichheit, Solidarität, und Würde zugrunde liegt“, sagte Coralie Dubost, Gesetzgeberin der regierenden La Republique en Marche Partei, vor versammelten Parlament. Wie sie auf Twitter mitteilte, wurde das Gesetz nach 500 Stunden Debatte und 12,000 Änderungen endlich bestätigt. Zuvor hatte sich der konservativ geführte Senat bemüht, die Möglichkeit für alleinstehende und lesbische Frauen von der französischen Sozialversicherung für medizinisch unterstützte Schwangerschaften finanziell unterstützt zu werden, zu verhindern. Da Präsident Emmanuel Macrons regierende Partei jedoch die Mehrheit im Unterhaus hält, wurde das Gesetz mit 326 zu 115 Stimmen beschlossen und tritt, sobald es von dem Präsidenten unterschrieben wurde, in Kraft. Gesundheitsminister Olivier Veran sagte, dass die ersten Schwangerschaften womöglich noch dieses Jahr entstehen könnten. Wie queer.de berichtete ist die Maßnahme Teil eines breitgefächerten Bioethik-Gesetzes der Regierung Macrons. Das neue Gesetz wird den Zugang zu Fertilitätsbehandlungen, unter andrem künstliche Befruchtung und IVF, erweitern. Es wird auch die Anonymität für Samenspendende beenden, die nun offiziell versichern müssen, ihre Identität offenzulegen, wenn ihre Kinder ab ihrem 18. Lebensjahr nach ihrem biologischen Vater oder Elternteil fragen sollten. Das Gesetz bezieht sich jedoch weder auf das umstrittene Verbot von Leihschwangerschaften noch auf die geforderte Möglichkeit für trans Frauen vor geschlechtsangleichenden Operationen Samen für späteren Nutzen spenden zu können. LGBTQ*-Gruppen empfingen die bisherigen Änderungen jedoch mit einem „Endlich!“, wie Matthieu Gatipon, Sprecher*in der Inter-LGBT Vereinigung: „Das war ein lang-erwarteter Prozess“, und weiter, „Wir sind froh, dass das passiert… aber es war eine schmerzhafte Geburt“, sagte Gatipon in Bezug auf die lange Dauer der Gesetzänderung. Seit 2013 in Frankreich gleichgeschlechtliche Ehen legalisiert wurden, bemühten sich LGBTQ*-Gruppen um diesen Schritt. Nun sei die Nachfrage so hoch, dass Fabien Joly, Sprecher der Vereinigung französischer gleichgeschlechtlicher Familien, warnte, dass es einen Mangel an Samenbeständen geben könnte.
Weiterlesen Ende April brachte die Linksfraktion deswegen den Antrag „Trans*-Gesundheitsversorgung in die Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen aufnehmen“ in den Bundestag.
Bislang gäbe es, so Doris Achelwilm, queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion, einen „bürokratischen Hürdenlauf für trans* Personen bei den Krankenkassen“. Jenen werde standardmäßig keine Transition, sondern eine psychotherapeutische Behandlung angeboten – obwohl, wie im Antrag angebracht wird, trans* Personen in den aktualisierten WHO-Klassifikationen" nicht mehr psycho-pathologisiert werden". Erst kürzlich hatte auch die Bundespsychotherapeuten-Kammer (BPtK) den Therapiezwang „vorher mindestens sechs Monate und mindestens zwölf Sitzungen à 50 Minuten“ behandelt zu werden, dem trans* Personen im Zuge einer Geschlechtsanpassung unterliegen, scharf kritisiert und eine Rücknahme der entsprechenden Richtlinie gefordert.
„Aus fachlicher Sicht muss die ablehnende Praxis gegenüber der medizinischen Versorgung von trans* Personen längst der Vergangenheit angehören“, so Achelwilm: „Was fehlt, ist, dass die Krankenkassen endlich mitziehen.“ Denn noch finde die Gesundheitsversorgung im Zuge etwa einer Geschlechtsangleichung „unter kolossal falschen Voraussetzungen“ statt.
Der Linken-Antrag fordert deswegen eine verbesserte Kostenübernahme für operative Maßnahmen, für Epilation oder Hilfsmittel wie beispielsweise Perücken. Trans* Personen müssten endlich regulär anerkannt werden. Der Antrag sei umso wichtiger, da das völlig veraltete „Transsexuellengesetz“ trotz Versprechen der Großen Koalition auch in dieser Legislaturperiode nicht reformiert wird – obwohl bereits mehrere Teile des 1981 in Kraft getretenen „Transsexuellengesetzes“ für verfassungswidrig erklärt wurden.