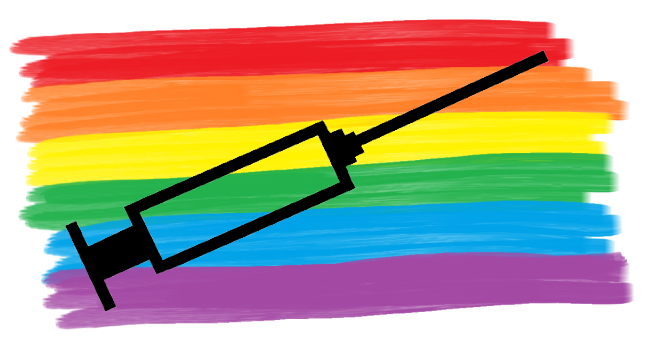Weiterlesen Wie das Unternehmen letzte Woche in der Datenbank für klinische Studien des National Institute of Health (NIH) bekannt gab, erprobt es seinen neuen mRNA-basierten Impfstoff nun am Menschen. Voraussichtlich soll die Studie, die am 19. August begann, im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Berichten zufolge entwickelt Moderna auch einen Grippeimpfstoff, der auf der gleichen Technologie basiert. Die Impfstoffe von Moderna haben Anfang des Jahres die Phase-I-Tests bestanden, bei denen er nur an einer Handvoll menschlicher Freiwilliger auf ihre Sicherheit geprüft wird. In Phase II wird die Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs getestet, und mit dem Übergang in Phase III wird Moderna die Wirksamkeit des Impfstoffs im Vergleich zu anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Präventionsbehandlungen, wie der Präexpositionsprophylaxe, auch bekannt als PreP, untersuchen. Seit den späten 1700er Jahren haben Forschende verschiedene Arten von Impfstoffen entwickelt, aber die meisten Impfstoffe für andere Viren haben sich als unwirksam gegen HIV erwiesen. Das Virus greift das Immunsystem selbst an und beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, andere Krankheiten und Infektionen zu bekämpfen. Anders als inaktive oder Lebendimpfstoffe enthalten mRNA-Impfstoffe keine Teile eines Virus. Stattdessen erzeugen sie Proteine, die selbst eine Immunreaktion im Körper auslösen. Auf diese Weise werden mehrere Nachteile anderer Impfstoffe beseitigt. Lebendimpfstoffe können verderben, wenn sie nicht kühl gelagert werden, was ein Problem für die weite Distribution darstellt, und gleichzeitig die Möglichkeiten der Hersteller zur Massenproduktion von Dosen einschränkt. Derzeit sind 16 HIV-Mutationen bekannt. Sollten neue impfstoffresistente HIV-Formen auftreten, könnten die Forscher die mRNA so bearbeiten, dass sie mit weit weniger genetischem Material als andere Impfstoffe leicht veränderte Proteine produziert. Obwohl es die mRNA-Impfstofftechnologie schon seit Jahrzehnten gibt, hat die lange Zulassungszeit bei der Food and Drug Administration (FDA) die Zahl der mRNA-Impfstoffe, die schließlich in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen, begrenzt. Die COVID-19-Pandemie änderte dies jedoch, da das letztjährige öffentlich-private Partnerschaftsprogramm „Operation Warp Speed“ den Zeitplan für klinische Impfstoffversuche und die FDA-Zulassung beschleunigte. „COVID-19 hat uns gezeigt, was wir tun können, wenn wir einen Impfstoff schnell auf den Weg bringen wollen“, sagte Dr. Andrew Pekosz, Virologe und Professor an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, gegenüber der Gesundheitsnachrichten-Website VeryWell. Sollte sich der HIV-mRNA-Impfstoff als wirksam erweisen, sagen Befürworter des Projekts, dass ein HIV-Impfstoff für die globale Gesundheit von entscheidender Bedeutung wäre. „Die einzige wirkliche Hoffnung, die wir haben, um die HIV/AIDS-Pandemie zu beenden, ist der Einsatz eines wirksamen HIV-Impfstoffs, der durch die Arbeit von Partnern, Befürwortern und Gemeindemitgliedern erreicht wird, die sich zusammentun, um gemeinsam das zu tun, was kein Einzelner oder eine Gruppe allein tun kann“, schrieb der Präsident der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), Dr. Mark Feinberg, im Juni in einer Erklärung zum 40-jährigen Jubiläum der HIV-Epidemie. Auch die Wissenschaftler von Moderna sind mit ihren Bemühungen nicht allein: Im Juli begannen an der Universität Oxford die Phase-I-Tests für einen „Mosaik“-Impfstoff. Beide könnten dazu beitragen, die Ausbreitung eines der heimtückischsten Viren der Welt im kommenden Jahrzehnt zu stoppen.
Aufklärung und Bildung
Angriffe auf Regenbogenfahnen
20. September 2021Weiterlesen In Brandenburg setzten Unbekannte eine 90 mal 150 Zentimeter große Regenbogenfahne in Brand, die an einem Bürogebäude befestigt war. In Bielefeld wurden zwei Regenbogenfahnen von einem Frauenkulturzentrum gerissen und angezündet. Auch in Bayern und Köln kam es zu Vorfällen. Laut der Redaktion von queer.de liegt das Bekanntwerden von mehr Angriffen auf Regenbogenflaggen eventuell daran, dass die Öffentlichkeit inzwischen sensibler auf Hasskriminalität reagiere. Auch könne es sein, dass derzeit mehr Pride-Fahnen durch Deutschland wehten. Da es jedoch fast täglich zu Meldungen von solchen Vorfällen komme, könne befürchtet werden, dass es sich um eine Welle handele. Die Regenbogenfahne, auch Pride Flag genannt, entstand in Ende der Siebziger Jahre in San Francisco. Damals beauftragte Harvey Milk den Künstler Gilbert Baker damit, ein Symbol für die queere Community zu kreieren. Seitdem nutz die LSBTIQ-Community und ihre Allies die Fahne, auch in Abwandlungen und Weiterentwicklungen, um ihre Identität stolz nach außen zu tragen oder um Unterstützung zu symbolisieren.
Homofeindlicher Angriff in Berlin
10. September 2021Weiterlesen Wie die Hauptstadtpolizei am Sonntag meldete, habe ersten Erkenntnissen zufolge der Mann die Bar gegen 4.45 Uhr verlassen, wo ihn schon zuvor zwei 18-jährige Männer bedrängt und homophob beleidigt haben sollen. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Angreifer auf den Mann eingeschlagen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen sie zudem versucht haben, ihrem Opfer die Handtasche zu entreißen. Als dies misslang, soll einer der Täter das Handy aus der Tasche des Angegriffenen gestohlen und ihn bedroht haben. Eine Passantin, die den Vorfall beobachtete, sei dann zum nahegelegenen Polizeiabschnitt geeilt und habe den Vorfall gemeldet. So konnten die Beamt*innen die Tatverdächtigen schließlich noch vor Ort festnehmen. Der Angegriffene erlitt jedoch leichte Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten, so die Polizei. Die Berliner Polizei macht mögliche Gewalttaten aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTQI*. Weil dies jedoch noch nicht überall im Bund üblich ist, wird sich die nächste Innenministerkonferenz der Länder auf Initiative Berlins erstmalig mit Hasskriminalität gegen queere Menschen befassen – ein Thema, das von den Verantwortlichen viel zu lange ignoriert wurde.
Bedrohungen und Angriffe: Queerfeindliche Gewalt in Sachsen
6. September 2021Weiterlesen Wie Queer.de berichtet musste der erste Christopher Street Day im sächsischen Taucha nach Störaktionen von Rechtsextremen aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden. Die von der linksjugend Nordsachsen organisierte Demonstration mit anschließender Kundgebung, unter dem Titel „Lieb doch, wen Du willst“, wurde ab 14 Uhr immer wieder von Neonazis gestört. Die Polizei sei überfordert gewesen, kritisierte ein Linke-Abgeordneter. So begründeten die Organisator*innen ihre Entscheidung des Abbruchs damit, dass sich die Teilnehmer*innen in der Kleinstadt nördlich von Leipzig nicht mehr sicher bewegen hätten können: „Wir haben den CSD aufgrund der aggressiven Faschos, welche weitere mobilisierten, abgebrochen“. Die Kundgebung, die ursprünglich bis 21 Uhr mit Musik und Redebeiträgen auf dem Marktplatz angemeldet gewesen war, wurde daher um 16 Uhr schon abgebrochen – aus Angst vor queerfeindlicher Gewalt. So wurden die Besucher*innen der vorzeitig beendeten Veranstaltung nach dem Eintreffen zusätzlicher Einsatzkräfte von Polizist*innen zum Bahnhof begleitet. Glücklicherweise kam es nicht zu gewaltsamen Übergriffen auf CSD-Teilnehmer*innen. Der Abgeordnete Marco Böhme schrieb danach in einem Tweet: „Danke an alle Teilnehmenden die für Vielfalt & eine offene Gesellschaft in Taucha auf der Straße waren. Da Sicherheit vorgeht, haben wir den CSD wegen rechten Störern vorzeitig beendet“. „Schon jetzt steht fest: Wir kommen zahlreich wieder!", kündigte auch Philipp Rubach, linker Direktkandidat in Nordsachsen, nach den Vorfällen in einem Statement an. Doch wie der Leipziger Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) auf Twitter kommentierte: „Taucha hat ein Problem“. In den vergangenen Monaten hatte auch die Initiative „Solidarische Alternativen für Taucha“ mehrfach auf Neonazi-Vorfälle in der sächsischen Kleinstadt aufmerksam gemacht. Dass ein CSD aufgrund von Rechtsextremen vorzeitig beendet werden musste ist nun ein drastisches Beispiel dafür, wie strukturelle queerfeindliche Gewalt (in diesem Fall von rechts motiviert) die Demonstrationsfreiheit einer ganzen Gruppe von Menschen einschränken kann.
Weiterlesen Die Taliban sind eine militärische Gruppe, die die Kontrolle über das Land übernommen hat und dafür bekannt ist, dass sie extreme islamische Ideale durchsetzt. Nach der Auslegung der Scharia durch die Taliban ist Homosexualität streng verboten und wird mit dem Tod bestraft. Als die Taliban das letzte Mal in Afghanistan an der Macht waren, zwischen Ende der 90er Jahre und 2001, war der 21-jährige Abdul noch nicht geboren. „Ich habe gehört, wie meine Eltern und die Älteren über die Taliban gesprochen haben“, sagte er gegenüber Radio 1 Newsbeat, „Wir haben einige Filme gesehen. Aber jetzt ist es, als wäre ich in einem Film“. Eigentlich sollte Abdul in dieser Woche seine letzten Universitätsprüfungen ablegen, mit Freund*innen zu Mittag essen und seinen Freund besuchen, den er vor drei Jahren in einem Schwimmbad kennen gelernt hat. Stattdessen sitzt er nun schon den vierten Tag in Folge in seinem Haus. Vor seiner Haustür stehen derzeit Taliban-Soldaten. „Selbst wenn ich die Taliban von den Fenstern aus sehe, habe ich große Angst. Mein Körper beginnt zu zittern, wenn ich sie sehe“, erzählt er. „Es werden Zivilisten getötet. Ich glaube nicht, dass ich jemals vor ihnen sprechen werde“. Doch nicht nur die neuen Machthaber des Landes dürfen nichts von Abduls Sexualität erfahren. „Als schwuler Mensch in Afghanistan darf man sich nicht zu erkennen geben, nicht einmal seiner Familie oder seinen Freunden gegenüber. Wenn ich mich meiner Familie offenbare, werden sie mich vielleicht schlagen, vielleicht töten“. Doch, obwohl er seine Sexualität verbarg, genoss Abdul sein Leben im pulsierenden Stadtzentrum des Landes. „Mein Studium verlief perfekt. Es war Leben in der Stadt, es gab viele Menschen in der Stadt.“ Nun, innerhalb einer Woche, hat Abdul das Gefühl, sein Leben vor seinen Augen verschwinden zu sehen. „Es gibt keine Zukunft für uns.“ „Ich glaube nicht, dass ich jemals meine Ausbildung fortsetzen werde. Zu meinen Freund*innen habe ich den Kontakt verloren. Ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht. Mein Partner sitzt mit seiner Familie in einer anderen Stadt fest. Ich kann nicht dorthin gehen, er kann nicht hierherkommen.“ „Ich leide unter schweren Depressionen. Ich denke daran, diese Sache einfach zu beenden. Ich will so ein Leben nicht mehr führen. Ich will eine Zukunft, in der ich frei leben kann und nicht von Leuten darauf hingewiesen werde, dass man hier nicht schwul sein darf.“ Abdul macht sich keine Hoffnungen auf die Versprechen der Taliban, anders zu regieren. „Selbst wenn die Taliban eine Frau in der Regierung oder in der Schule akzeptieren, werden sie niemals schwule oder LGBT-Menschen akzeptieren. Sie werden sie alle auf der Stelle töten.“ Abdul sagt, er warte darauf, „einen Weg zu finden, das Land zu verlassen“. Es gibt einige Organisationen und Aktivist*innen, die versuchen, queere Afghan*innen in Sicherheit zu bringen. Abdul habe gehört, dass das Vereinigte Königreich die Aufnahme von 20 000 Geflüchteten aus seinem Land plane, aber niemand wisse, wie man sich bewerben oder registrieren lassen könne. „Ich bin 21 Jahre alt. Mein ganzes Leben habe ich im Krieg verbracht, in Bombenangriffen, ich habe Freunde und Verwandte verloren“ – „Ich möchte nur sagen, falls jemand meine Botschaft hört, dass ich als junger Mensch das Recht habe, frei und sicher zu leben“, sagt Abdul abschließend.
Wie eine gemeinnützige Organisation versucht, LGBTQ-Geflüchteten aus Afghanistan zu helfen
26. August 2021Weiterlesen Wie in vielen Konflikten sind LGBTQI*-Personen in Afghanistan in besonderer Weise gefährdet. Gleichgeschlechtliche Intimität wurde bereits unter der früheren afghanischen Regierung mit Gefängnishaft oder sogar mit dem Tod bestraft, und Aktivist*innen befürchten, dass LGBTQI*-Personen unter den Taliban noch stärker von Gewalt bedroht sein werden, und verweisen auf die strenge Auslegung der Scharia, mit der die Gruppe während ihrer Regierungszeit von 1996 bis 2001 regierte. Obwohl sich die heutigen Taliban als gemäßigter darstellen, sind viele Menschenrechtsgruppen weiterhin besorgt. Erst letzten Monat erklärte ein Taliban-Richter gegenüber der deutschen Boulevardzeitung Bild, dass homosexuelle Männer zu Tode geprügelt werden sollen. Rainbow Railroad, eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die LGBTQI*-Personen, die verfolgt werden, helfen will, bereitet sich darauf vor, LGBTQI*-Afghanen bei ihrem Fluchtversuch zu unterstützen. Die 2006 in Kanada gegründete Organisation hilft LGBTQI*-Personen, aus Ländern zu fliehen, in denen sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität unmittelbar bedroht sind. Die Gruppe beantwortet jedes Jahr über 3 000 Anfragen und hilft jährlich etwa 200 Menschen, die Grenzen zu überschreiten. Rainbow Railroad hat in diesem Jahr bereits 50 Hilfegesuche von Menschen aus Afghanistan erhalten und rechnet in naher Zukunft mit einem weiteren Anstieg. Das US-Amerikanische TIME Magazin sprach mit Kimahli Powell, der Geschäftsführerin von Rainbow Railroad, über die aktuelle Situation von LGBTQI* in Afghanistan. Auf die Frage, ob Rainbow Railroad daran arbeite, allen zu helfen, die derzeit versuchen, Afghanistan zu verlassen, erklärte Powell, dass LGBTQI*-Organisationen in Afghanistan aus verschiedenen Gründen sehr eingeschränkt seien, unter anderem, weil sich das Land in einem ständigen Kriegszustand befindet und einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert werden. Es gäbe nur wenige Menschenrechtsverteidiger, an die man sich wenden könne, und es gäbe nur wenige Organisationen, die Unterstützung anbieten. Das ist der Kontext, in dem Rainbow Railroad in der Region tätig ist. Wichtige Partnerschaften seien jedoch für Rainbow Railroad von großer Bedeutung, um gefährdete Menschen zu identifizieren, denn es sei wirklich schwierig, Afghan*innen zu finden, die bereit seien, überhaupt das Risiko einzugehen, sich im Internet als Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft zu outen. Trotzdem erhalte Powells Organisation immer wieder Hilfesuchen aus Afghanistan, allein in diesem Jahr seien es mindestens 50 gewesen, meisten Anfragen von Einzelpersonen. Man gehe jedoch davon aus, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weitere geben wird. Um zu versuchen, mehr Menschen zu erreichen, stütze man sich derzeit auf das weitreichende internationale Netzwerk und Kontakte im Land. Doch die Situation sei sehr instabil, so Powell: „Wenn ich sage, dass wir mit einem sprunghaften Anstieg der Anfragen rechnen, dann meine ich damit, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Menschen versuchen werden, sich auf jede erdenkliche Weise an uns zu wenden, und dass wir auf der Suche nach Lösungen sein werden“. Im Moment sei die Situation für queere Menschen in Afghanistan unklar, da die Taliban die Macht übernommen haben. Doch schon im Gesetz der vorherigen Regierung wurde einvernehmliches gleichgeschlechtliches Handeln kriminalisiert. Dies habe, so Powell, zu einer Kultur der Belästigung und Gewalt durch die Polizei sowie zu einer Kultur der Diskriminierung geführt. Die Menschen hätten keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten und würden ihre Arbeitsstellen verlieren, wenn sie sich outen. LGBTQ-Personen könnten nicht melden, wenn sie diskriminiert, angegriffen, vergewaltigt oder verhaftet werden. So seien LGBTQI* schon vor der Machtergreifung der Taliban dieser Art von Diskriminierung ausgesetzt gewesen. Nun sorgt Powell sich, angesichts der Trends im Nahen Osten und in Nordafrika, dass Queerfeindlichkeit unter diesem Regime noch zunehmen würden. Doch für die Afghan*innen, die flüchten und sich im Ausland neu ansiedeln werden können, gilt, dass sie die Unterstützung von Gemeinschaften brauchen, insbesondere von LGBTQ-Gemeinschaften. „Sie brauchen Zugang zu Wohnraum, sie brauchen Zugang zu emotionaler und psychischer Unterstützung, sie brauchen Zugang zu Ressourcen. Ich denke, das ist die Chance, die Einzelpersonen, Zivilgesellschaften und Regierungen bieten können“.
Weiterlesen In einem Artikel der Independent Zeitung beschreibt Umber Ghauri, die selbst queer ist und eine Behinderung hat, dass viele in der Community gar nicht fragen würden, was sie als Mensch mit Behinderung braucht. So würden sie nach ihren eigenen Vorstellungen Räume für Menschen mit Behinderung schaffen, und dann perplex darüber sein, warum Menschen mit Behinderung nicht dabei sind. Es sei deswegen wichtig, als Community ein tiefergehendes Gespräch über Barrierefreiheit führen. Ein Beispiel, welches sie dafür anbringt, ist dass LGBTQ+-Initiativen oft über wenig finanzielle Mittel verfügen, so dass ein stufenloser Zugang wie ein Luxus erscheinen könne. Für Menschen, die einen stufenlosen Zugang benötigen, ist er jedoch eine Notwendigkeit. Und selbst wenn ein Raum über einen stufenlosen Zugang verfügt, sind möglicherweise keine barrierefreien Verkehrsmittel in der Nähe verfügbar. Darüber hinaus hätten sich viele queere Communities um Nachtleben und Aktivismus herum gebildet – mit einer Behinderung sind Proteste, Märsche und Clubnächte jedoch oftmals nicht gut zugänglich. „Diese Orte sind daher oft enttäuschend exklusiv“, schreibt Ghauri, und weiter: „Menschen mit Behinderung werden als lästig betrachtet, als Nachzügler. Und wenn wir nicht von Anfang an mitgedacht werden, kann man darauf wetten, dass das Ergebnis eines ist, das uns ausschließt“. Dieser Mangel an Barrierefreiheit dränge queere Menschen mit Behinderung immer weiter aus der Community heraus. Es müsse ein Verständnis entstehen, dass zwar alle unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen haben, man aber immer noch eine Gemeinschaft sei. Dabei hätten alle LGBTQI* die Verantwortung, Menschen mit Behinderung nicht nur einzubeziehen, sondern zu unterstützen, denn, so Ghauri: „Ohne uns übersehen Sie einen großen Teil der LGBTQ+ Menschen und repräsentieren daher unsere Gemeinschaft nicht ausreichend“. Einige Lösungen seien hier einfach: stufenlose Zugänge, genügend Sitzgelegenheiten, viel Platz, Berücksichtigung barrierefreier Verkehrsmittel. Andere jedoch seien schwieriger: die Annahme zu zerstören, dass Behinderung immer sichtbar sei, die Annahme in Frage zu stellen, dass Menschen mit Behinderung weniger zu bieten hätten als Menschen ohne Behinderung, und die Stimme von Menschen mit Behinderung zu verstärken: „Für viele von uns ist eine Behinderung genauso ein Teil unserer Identität wie LGBTQ+ zu sein“. Wenn behinderte Menschen also von queeren Räumen ausgeschlossen werden, spalte das die ganze Community.
Weiterlesen Kritiker*innen des Gesetzes hatten gewarnt, dass es Homosexualität in Ungarn weiter stigmatisieren würde, da das Gesetz, mit dem es verknüpft ist, auch härtere Strafen für Pädophilie vorsieht. Das neue Dekret, das Kinderbuchhändler*innen dazu verpflichtet Bücher und Medien mit queeren Inhalten im buchstäblichen Sinne zu verstecken, ist dafür nur ein Beispiel. Dabei bezieht sich die neue Verordnung auf die öffentliche Zurschaustellung von Produkten, die Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit zeigen, genauer gesagt gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Geschlechtsumwandlungen. Im Umkreis von 200 Metern von Schulen oder Kirchen verbietet das Gesetz den Verkauf solcher Produkte sogar vollständig. Die Maßnahme lässt sich dabei einordnen in eine breiter angelegte Kampagne der Regierung gegen die queere Community, die sie als Kampf für Familienwerte und den Schutz von Kindern darstellt. Mit dem Argument, dass die Sexualerziehung den Eltern überlassen werden sollte, ist das ursprüngliche Gesetz eine umfassende Maßnahme zur Verhinderung von queeren Inhalten in der Bildung. Die ungarische Gesellschaft ist in der Frage von LGBTQI*-Rechten gespalten, aber Tausende nahmen an der Gay Pride Parade 2021 in Budapest teil. Eine Ipsos-Umfrage vom letzten Monat ergab, dass 46 % der Ungarn die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, nannte das Gesetz eine „Schande“. Die Europäische Kommission hat rechtliche Schritte gegen Ungarn eingeleitet. Sie bezeichnet das Gesetz als diskriminierend und argumentiert, es verstoße gegen die Werte der 27 Nationen, nämlich Toleranz und individuelle Freiheit.
Weiterlesen Ein Positiv-Beispiel dafür lieferte Formel-1 Star Sebastian Vettel am vergangenen Sonntag bei einem Rennen in Budapest, Ungarn: Während der ungarischen Nationalhymne legte er sein Regenbogen-Shirt mit der Aufschrift „Same Love“ (und Schuhe, Shirts, Helm und Masken in Regenbogenfarben) nicht ab, obwohl die Hymne des Gastgeberlandes respektiert werden solle, indem die Fahrer ihre Rennanzüge tragen würden, sagte der Rennleiter Michael Masi. So erhielt Vettel eine allgemein formulierte erste Verwarnung, welche allerdings ohne direkten Rennbezug keine weiteren Konsequenzen für den Fahrer haben wird. Doch bevor seine Strafe entschieden wurde, sagte er in einem Interview: „Ich kann damit leben, wenn sie mich disqualifizieren. Sie können mit mir machen, was sie wollen, das kümmert mich nicht. Ich würde es wieder machen.“ Er betonte, dass das Shirt vor dem Hintergrund der queer-feindlichen Politik Ungarns „ein kleines Zeichen der Unterstützung“ für queere Menschen gewesen sei: „Ich finde es peinlich für ein Land, das in der EU ist, solche Gesetze zu haben“, so Vettel konkret zum ungarischen Gesetz gegen Homo- und Trans-„Propaganda“. Er könne nicht verstehen, warum die Regierung so damit kämpfe, dass die Menschen einfach frei leben könnten, wie sie wollten. Hintergrund der Äußerungen ist ein Mitte Juni vom ungarischen Parlament beschlossenes Gesetz, das jegliche Darstellungen von Homo- oder Transsexualität in Büchern, Filmen, anderen Medien, und an Schulen verbietet. Zwar hat die EU hierzu bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, doch hält die rechtsnationale Regierung trotz internationaler Kritik an dem Gesetz fest – und will sich durch ein Referendum den Rückhalt der ungarischen Gesellschaft holen. Wie die Ungar*innen abstimmen werden ist noch unklar, doch auch sie haben Vettels Regenbogen-Aufzug gesehen und sind dadurch vielleicht beeinflusst worden. Dass jedoch nicht alle Promis ihre Plattform für Allyship nutzen, sondern sich sogar öffentlich gegen queere Menschen äußern, hat sich Ende Juli gezeigt, als der US-Rapper DaBaby bei dem Rolling Loud Festival in Miami behauptete, Aids sei eine „schwule Krankheit“. So rief er seine Fans auf, ihre leuchtenden Smartphones in die Höhe zu halten, „wenn ihr heute nicht mit HIV, Aids oder einer anderen sexuell übertragbaren Krankheit hergekommen seid, an der ihr in zwei, drei Wochen sterben werdet“. Zwar wurden diesen Falschaussagen schnell widersprochen, indem zum Beispiel der Musiker Elton John DaBaby vorwarf , Fehlinformationen zu verbreiten und eine Reihe von Fakten über HIV teilte; so tragen homofeindliche Tiraden bewunderter Stars zur unter anderem zur Stigmatisierung der Immunschwäche-Krankheit bei. „HIV-Fehlinformationen und Homophobie haben keinen Platz in der Musikindustrie“, teilte Elton Johns Aids Stiftung deswegen mit, eine Botschaft, die auch die Veranstalter*innen des US-Musikfestivals Lollapalooza unterstützten, indem sie DaBabys Auftritte absagten „Lollapalooza wurde auf der Basis von Vielfalt, Inklusivität, Respekt und Liebe gegründet. In diesem Sinne wird DaBaby nicht mehr im Grant Park auftreten“. Die Reaktion Elton Johns, des Lollapalooza, und unter anderen auch der Sängerin Dua Lipa, die sich von DaBaby distanzierte, sind Beispiele dafür, wie wichtig es ist entschieden gegen Fehlinformationen und homofeindliches, menschenverachtendes Verhalten vorzugehen – und Promis, die ihre Reichweite so nutzen, im wahrsten Sinne des Wortes keine Bühne zu bieten. Denn mit Prominenz kommt nicht nur Reichweite, sondern damit verbunden eine Verantwortung, und die wertvolle Möglichkeit, sich für marginalisierte Menschen und Themen einzusetzen – statt sie weiter zu stigmatisieren.
Homofeindliche Angriffe in München und Berlin
4. August 2021Weiterlesen Laut Polizeibericht vom Sonntag ereignete sich der Vorfall in München gegen 17.30 Uhr, als sich die betroffene Schülerin zusammen mit Freund*innen im Hirschgarten aufhielt. Dort wurde sie von zwei jungen Männern aus München zunächst angepöbelt und im weiteren Verlauf körperlich attackiert. Anlass des Angriffs war nach ersten Erkenntnissen die Pride-Flagge, die die 13-Jährige um die Schultern trug. Als ihr ein 14-jähriger Schüler zur Hilfe kam, wurde auch dieser attackiert, wobei er zu Boden fiel und weiter körperlich malträtiert wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Während Rettungskräfte die beiden verletzten Jugendlichen versorgten, konnte jedoch noch einer von ihnen festgenommen werden. Der 18-jährige Münchner wurde allerdings nach Aufnahme der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt, nach dem zweiten Angreifer wird weitergesucht. Die Polizei sucht Zeug*innen der Tat, daher werden Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, gebeten, sich mit dem Münchener Kriminalfachdezernat 4 in Verbindung zu setzen (unter der Telefonnummer (089) 63007-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle). Der Vorfall in Berlin geschah, wie die Polizei der Hauptstadt am frühen Samstagnachmittag nach aktuellem Ermittlungsstand meldete, als der 39-Jährige gerade auf dem Hof des Mehrfamilienhauses an der Straße der Pariser Kommune saß, und drei unbekannte Männer zu ihm kamen und ihn homofeindlich beleidigt haben sollen. Einer der Männer soll ihm anschließend gegen den Brustkorb getreten haben, sodass der Angegriffene nach hinten fiel. Um dem Angriff zu entkommen, flüchtete der 39-Jährige in seine Wohnung und schloss die Wohnungstür. Die Männer folgten ihm bis zur Tür, gegen diese sie mehrmals traten, bis sie aufsprang. Während dessen alarmierte der 39-Jährige die Polizei und die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter wurden im Polizeibericht nicht näher beschrieben. Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI.