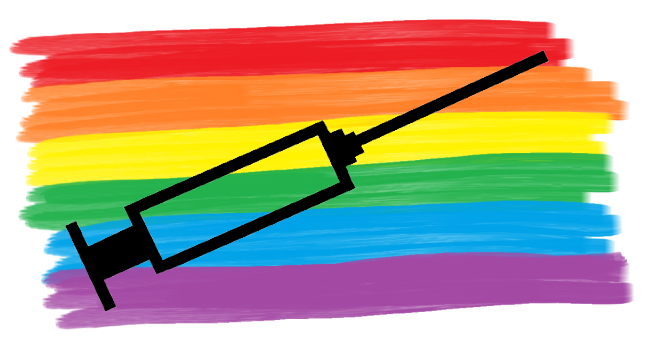Hamburg bekommt Denkmal für sexuelle Vielfalt
20. Februar 2021Weiterlesen Im September letzten Jahres lud daher die Kulturbehörde zu einem Workshop ins Museum für hamburgische Geschichte ein. Dort wurden Perspektiven für das Design und den Standort des Denkmals erörtert. Bereits seit 2018 setzt sich eine private Initiative für die Errichtung eines solchen Denkmals ein. Ein Gründungsmitglied der Initiative, der Historiker Gottfried Lorenz, weist in diesem Zusammenhang auf die spezielle Geschichte der LSBTIQ*-Community in Hamburg hin. In der Hansestadt entstanden zwischen 1945 und 1994 Vereine und Orte der Community, während diese in anderen Städten polizeilich verhindert wurden. Das Denkmal soll dabei nicht nur dem Erinnern dienen. Farid Müller, Sprecher für LSBTIQ* der Bürgerschaftsfraktion der Grünen erläutert hierzu gegenüber der Taz: „Ein Denkmal geht in der Regel in die Vergangenheit. Den Initiator*innen soll es gelingen, dass das Denkmal in die Zukunft strahlt.“ Im Gespräch für den Standort des Denkmals sind unter anderem St. Georg, die HafenCity und der Jungfernstieg.
Ein Gegenwartsbezug des Denkmals ist auch dringend notwendig, denn noch immer leben LSBTIQ* nicht gleichberechtigt mit der Mehrheitsgesellschaft zusammen. Initiator Lorenz weist daraufhin, dass auch gegenwärtig Menschen mit homosexuellen Orientierungen diskriminiert werden: „Nach wie vor ist das Händchenhalten oder Küssen zwischen Männern oder Frauen in der Öffentlichkeit etwas, was Anstoß erregen kann. Deshalb soll das Denkmal auch eine Aufforderung für Toleranz und Akzeptanz der verschiedenen Gruppierungen sein“