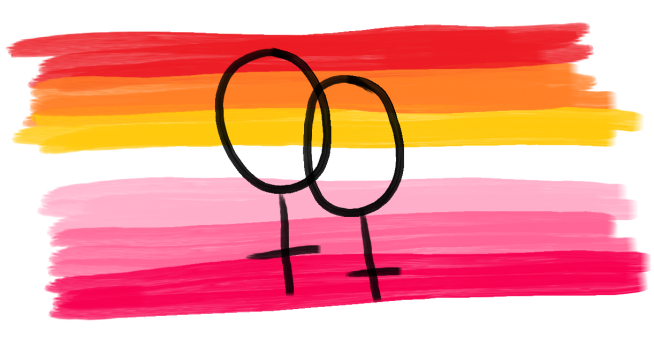Warum wir die Pride in Deutschland brauchen
23. Juli 2021Weiterlesen In einer aktuellen Studie, die Europäische Länder nach ihrer LSBTIQ*-Freundlichkeit einstuft, ist Deutschland auf Platz 16 von 49 gelandet – und damit nicht einmal unter dem besten Viertel vertreten. Eine höhere Einstufung wurde dabei vor Allem wegen Fällen von Diskriminierung und Hass-Rede verhindert. Wie eine trans Frau in einem Video der Deutschen Welle schildert, gäbe es noch viele Gebiete in Deutschland (vor Allem im ländlichen Raum) wo es „unglaublich schwer“ sei offen queer zu leben ohne Diskriminierung zu erfahren. In diesen Gegenden bestünden noch „sehr, sehr starke Normen, gerade in Hinblick auf Geschlecht“. Ein schwuler Mann erklärt in demselben Video: „So lange ein 14-jähriger Junge auf dem Land noch Angst haben muss sich zu outen, brauchen wir Pride“. Doch nicht nur auf dem Land, sondern auch in (Groß-)Städten, welche oft als offener gelten, besteht noch Luft nach oben was die Akzeptanz, Rechte und Repräsentation queerer Menschen angeht. So erzählt ein Demonstrant in einem Queer.de-Vlog über die Marzahn-Pride 2021: „In Marzahn zu leben als Homosexueller ist manchmal echt 'ne Tortur, da der Großteil der Bevölkerung in Marzahn-Hellersdorf leider sehr homophob und rechts angehaucht ist“ – er meide den Stadtteil deswegen. Auch in anderen Berliner Stadtteilen (unter anderem Kreuzberg) ereigneten sich erst letzte Woche, wie echte-vielfalt.de berichtete, homofeindliche Angriffe auf einen Mann und auf ein lesbisches Paar. Die Frage danach, ob es in Deutschland noch Pride brauche, lässt sich folglich unschwer bejahen. Auf der einen Seite, weil es, wie die obigen Schilderungen und Ereignisse zeigen, noch eine deutliche Verbesserung im Bereich der gesellschaftlichen Akzeptanz und Wertschätzung queerer Menschen braucht. Darüber hinaus ist die Ehe für Alle nur eine Errungenschaft unter einer Reihe von Rechten, die es noch zu reformieren gilt: So gibt es in Deutschland noch immer ein Blutspende-Verbot für schwule Männer, und das veraltete sogenannte „Transsexuellen-Gesetz“ wurde auch in dieser Legislatur-Periode nicht wie versprochen reformiert. Es zwingt trans Personen für die rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität immer noch Gutachten vorzuweisen, die bestätigen, dass sie wirklich trans* sind. Es lassen sich also viele politische Gründe finden, für die es sich absolut lohnt, an Pride noch auf die Straße zu gehen und für eine queer-freundlichere Welt zu demonstrieren. Wichtig ist jedoch auch, dass queere Menschen durch Pride auch weiterhin einen Raum haben, indem ihre Existenz explizit anerkannt und gefeiert wird. Solange das für sie nicht wie für heteronormative Mehrheitsgesellschaft zum Alltag gehört, braucht es, selbst nach allen möglichen politischen und rechtlichen Errungenschaften, Pride in Deutschland – und auf der ganzen Welt.