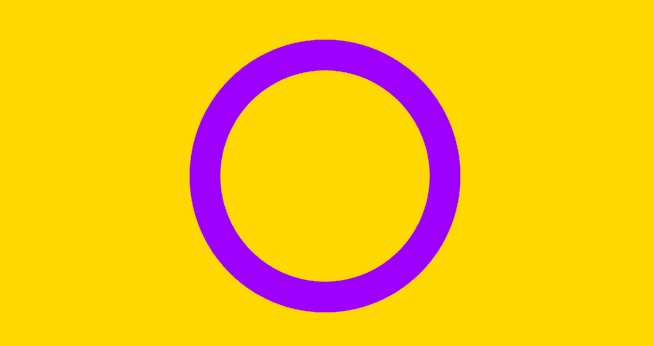Dies kann für betroffene Queers, die zu ihren Großeltern kein Verhältnis haben, in dem sie sich outen können, extrem schwierig sein. Auch dann, wenn sie vor ihren Eltern und Geschwistern längst geoutet sind. Gerade in Situationen wie Geburtstagen oder Urlauben, in denen erklärt werden müsste, wer der*die Partner*in ist, können innere Konflikte entstehen: Einerseits besteht selbstverständlich der Wunsch danach, sich frei ausleben und wie immer verhalten zu können – andererseits gibt es verschiedene Fragen: Versteht mein Großelternteil überhaupt, was ich meine, wenn ich mein*e Partner*in als solche, oder als mein*e Freund*in vorstelle? Oder muss ich mich offensiver outen? Wie reagieren sie, wenn ich der Person einen Kuss gebe? Könnte ein Streit entstehen?
Diese Sorgen können Menschen potenziell daran hindern, sich vor ihren Großeltern zu outen – was sich wie ein emotionaler Rückschlag anfühlen kann. Gerade wenn sie schon seit Jahren geoutet sind und ihre Sexualität nicht mehr groß „mitdenken“ müssen, kann das Geheimnis vor den Großeltern stark an alte Gefühle erinnern – „Und plötzlich bist du wieder im Closet“.
Das Coming Out vor den Großeltern ist also eine hochkomplizierte Angelegenheit, die oftmals viel mit Sexualitäts- und Gendervorstellungen zusammenhängen, die in einer Zeit geprägt wurden, in der sexuelle und geschlechtliche Vielfalt noch stärker unterdrückt wurden, als sie es zum Teil noch heute werden. So schmerzlich das Ergebnis daraus sein kann, so kann dies paradoxerweise auch zu Verständnis führen. Alok Vaid-Menon, Autor*in und Performer*in, sagt in einem Gedicht über das Coming Out als trans Person vor der Großmutter und ihrer negativen Reaktion darauf: „I refuse to call my Grandmother transphobic. I will not blame her for her own violence“ – auf Deutsch; „Ich weigere mich, meine Großmutter als transphob zu bezeichnen. Ich werde ihr für die Gewalt, die sie selbst erfahren hat, keine Schuld geben“. Damit bezieht sich Alok auf die noch stärkere Gender-Hierarchie und Unterdrückung geschlechtlicher Vielfalt in ihrer Generation, und findet so für sie Verständnis.
Dies bedeutet natürlich nicht, dass jede Person, die sich in irgendeiner Form als queer vor ihren Großeltern outet, Verständnis für deren negative und verständnislose Reaktionen zeigen muss. Es unterstreicht nur, dass das Coming Out vor den Großeltern eben ein komplizierter, potenziell schmerzhafter Prozess sein kann, der die Geschichte einer heteronormativen Gesellschaft spiegelt – aber eben auch, wie sich diese gerade in Teilen verändert und verändern kann.
Schließen