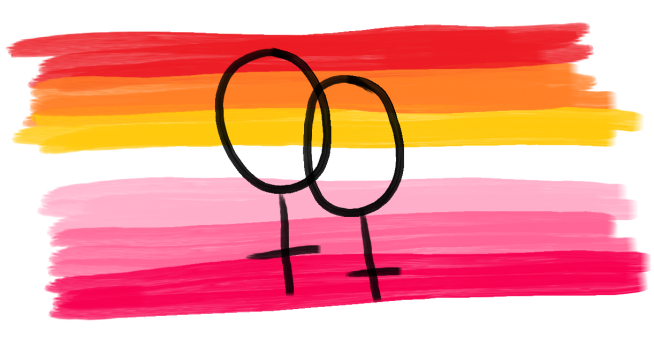Noch immer werden Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren rechtlich diskriminiert. Zwei Frauen gehen nun den rechtlichen Weg, um beide als Mütter in der Geburtsurkunde ihrer Tochter Paula eingetragen zu werden.
Weiterlesen
Gesa Teichert-Akkermann und Verena Akkermann fordern, mit heterosexuellen Elternpaaren rechtlich gleichgestellt zu werden. Denn bei diesen wird der Vater automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen, auch wenn eine biologische Vaterschaft nicht besteht, z.B. weil das Kind mit einer Samenspende entstanden ist. Homosexuelle Elternpaare müssen stattdessen nach der derzeitigen rechtlichen Regelung das lange dauernde Verfahren der Stiefkindadoption durchlaufen. Tochter Paula hat daher bisher rein rechtlich nur einen Elternteil.
Nach Ansicht der beiden Mütter ist Paula jedoch kein Adoptionskind, wie Verena Ackermann in einem Interview erläutert: „Wir haben uns von Anfang an gemeinsam für ein Kind entschieden. Sind jeden Schritt gemeinsam gegangen. Paula muss nicht adoptiert werden, denn sie hat mich und Gesa als ihre Mütter. Dass die Gesetze unseres Staates diese Tatsache nicht anerkennen, erleben wir als massive Diskriminierung und Ungleichbehandlung gegenüber heterosexuellen Paaren und Familien, dort fragt auch niemand nach der genetischen Elternschaft des Vaters.“
Gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für Freiheitsrechte kämpfen die beiden Frauen gegen ihre rechtliche Benachteiligung, von der vor allem auch Paula selbst betroffen ist. Nach der Gesellschaft für Freiheitsrechte zeigen die Fälle wie dieser auf, wie Familien derzeit bei der Anerkennung ihrer Elternschaft diskriminiert würden. Doch es prägten vielfältige Familienkonstellationen die Gesellschaft – etwa 14.000 Kinder würden in Deutschland in nicht heterosexuellen Familien aufwachsen.
Das Oberlandesgericht Celle beschäftigte sich nun am 13.01. mit dem Fall in einer Anhörung, zuvor waren bereits Anträge in erster Instanz vor dem Amtsgericht abgewiesen worden. Die Anwältin der beiden Frauen, Lucy Chebout, äußerte sich nach der Anhörung positiv: „Das war ein guter Tag! Das Oberlandesgericht Celle hat sich viel Zeit genommen, um die persönlichen und rechtlichen Dimensionen zu erörtern.“
Unter dem Hashtag #paulahatzweimamas kam es in den sozialen Medien, z.B. auf Twitter, zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen. So schreibt zum Beispiel eine Twitter-Userin: „Wenn es in einer Familie zwei Mütter gibt, müssen sie rechtlich gleichbehandelt werden. Weil dies bisher nicht geschieht, signalisiert man gesellschaftlich, dass solche Familien "nicht richtig" sind. Das ist falsch, und das ist Diskriminierung.“
Eine umfassende Reform des Abstammungsrecht sei nach dem Bundesjustizministerium in Arbeit. So lange wollen das Paar und ihre Unterstützer*innen jedoch nicht warten: "Es bleibt immer wieder bei Ankündigungen", kritisierte Gesa Teichert-Akkermann. "Wir vertrauen nicht darauf, dass uns der politische Prozess zu Recht verhilft. Bisher gab es nur Sonntagsreden, aber keine Anpassung der Gesetze."
Das Paar möchte den Rechtsweg weiter verfolgen – wenn notwendig mit einer Verfassungsbeschwerde.
Schließen