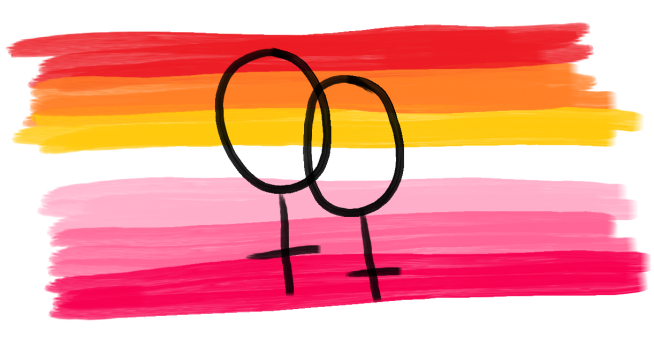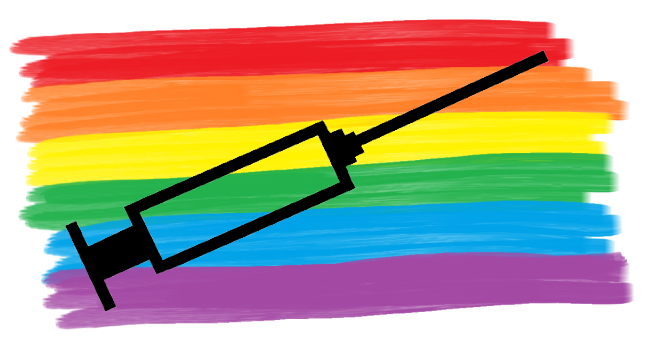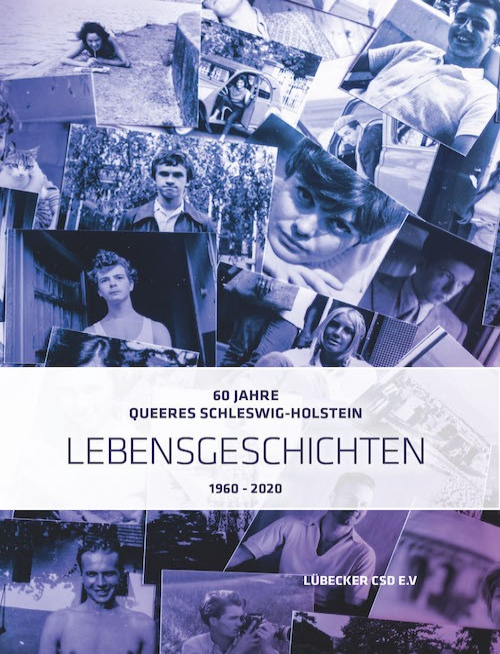Strengere Ahndung von Hasstaten gegen queere Menschen
30. Dezember 2022Weiterlesen Das „Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“, so der vollständige Name, verweist unter Punkt III. im Besonderen auf § 46 Absatz 2 StGB. Dieser benennt die Umstände, die bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. Dabei sind menschenverachtende Beweggründe bzw. Ziele besonders in Augenschein zu nehmen. Bis jetzt waren hier Punkte wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgeführt. Der neue Entwurf erweitert diese Liste um die Tatmotive „geschlechtsspezifisch“ und „gegen die sexuelle Orientierung gerichtet“. „Der Begriff „geschlechtsspezifisch“ soll dabei nicht nur die unmittelbar auf Hass gegen Menschen eines bestimmten Geschlechts beruhenden Beweggründe erfassen, sondern auch die Fälle einbeziehen, in denen die Tat handlungsleitend von Vorstellungen geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit geprägt ist.“ Der Text führt hierzu das Beispiel eines „patriarchalen Besitzanspruches“ eines „Täter[s] gegenüber seiner Partnerin oder Ex-Partnerin“ an. Hier muss – um Missbrauch für rechte Zwecke zu vermeiden - darauf aufmerksam gemacht werden, dass patriarchales Denken und Handeln in allen Schichten und kulturellen Hintergründen existiert. Während sich der erste Begriff vor allem auf Hass gegen Frauen bezieht, richtet sich der zweite Tatbestand deutlicher an Verbrechen gegen LSBTIQ* Personen: „Die ausdrückliche Nennung der „gegen die sexuelle Orientierung gerichteten“ Tatmotive betont die Notwendigkeit einer angemessenen Strafzumessung für alle Taten, die sich gegen LSBTI-Personen richten.“ Auf der offiziellen Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMSFSJ) bemerkt Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: „[…] Was Schwarz auf Weiß im Gesetzestext steht, findet in der Rechtspraxis mehr Beachtung. Die ausdrückliche Erwähnung dieser Beweggründe unterstreicht zudem, dass die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen schon frühzeitig solche Motive aufzuklären und zu berücksichtigen hat.“ Für Menschen, die Opfer solcher Taten geworden sind, bedeutet das zumindest in der Theorie, dass ihnen schneller Gehör geschenkt werden sollte, um somit mögliche blinde Flecken eher zu vermeiden. Es gilt allerdings zu bedenken, dass wir uns mit diesem Gesetz am äußersten Ende der Eskalation bewegen. Es bedeutet nämlich, dass ein Hassverbrechen bereits im Raum steht. Gerade der Begriff des „Patriarchalen“ macht deutlich, dass es sich bei solchen Taten immer auch um „Phänomene“ einer Sozialisation handelt, die nicht in einem luftleeren Raum entstehen, sondern Ergebnis von Strukturen und Erziehung sind. Der neue Entwurf betrifft daher nur eine Seite der Medaille, die ohne eine parallele zivilgesellschaftliche Veränderung nur Symptombekämpfung bleibt.