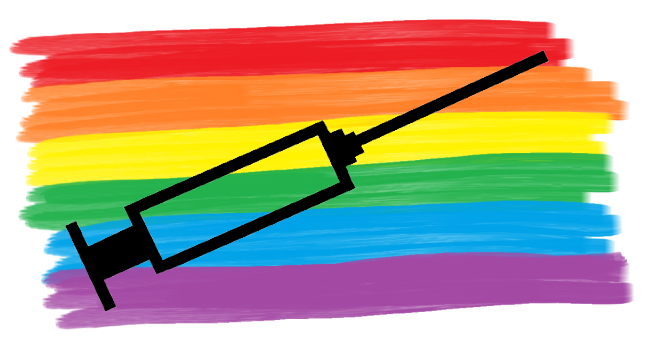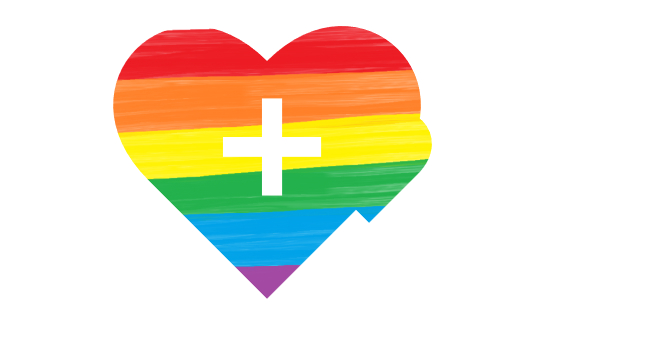Schottland, seine Gefängnisse und die Debatte um die Unterbringung von trans Straftäter*innen
3. Februar 2023Weiterlesen Erst vor wenige Tagen berichtete echte vielfalt darüber, dass die britische Zentralregierung das schottische Gesetz durch ihr Veto blockiert hatte und sich dabei u.a. auf das Argument der Schutzräume bezog. Vor diesem Hintergrund entbrannte nun eine Zuspitzung des Diskurses, als zwei trans Gefangene in ein Frauengefängnis verlegt werden sollten. In einem Fall handelt es sich um eine Sexualstraftäterin, die vor ihrer Geschlechtsanpassung zwei Frauen vergewaltigt hatte. Im anderen Fall um eine trans Straftäterin, die wegen einer Gewalttat gegen eine Krankenschwester und Stalking einer 13-Jährigen verurteilt wurde. Wie die Magazine queer und schwulissimo zusammenfassend berichten, wurde die Verlegung inzwischen nach massiver öffentlicher Kritik gestoppt. Auch wenn dieser Stopp gerechtfertigt ist, so kann an solchen extremen Beispielen nicht oft genug die Gratwanderung der Identitätsdebatte gezeigt werden. Wie die BBC mit Verweis auf den „Scottish Prison Service“ zeigt, befinden sich momentan 15 Transgender Straftäter*innen in schottischen Gefängnissen, darunter drei trans Männer und fünf trans Frauen, die in Frauengefängnissen untergebracht sind. Wie Justizminister Keith Brown gegenüber der BBC erklärte, gebe es in den Frauengefängnissen jedoch keine Transgender Gefangenen, die wegen Gewalt gegen Frauen verurteilt wurden. In Bezugnahme auf die beiden aktuellen Fälle erließ Brown nun eine Anordnung, dass keine bereits inhaftierte trans Person mit einer Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen von der Männer- in die Frauenabteilung verlegt werde. Gleiches gelte auch für neu verurteilte oder in Untersuchungshaft befindliche trans Gefangene mit einer Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig dementierte Brown, dass im Falle von Tiffany Scott (s.o., Fall zwei) überhaupt eine Genehmigung für einen Transfer vorgelegen habe. Beide Fälle machen dabei deutlich, dass das Argument zur Bewahrung geschlechtsspezifischer Schutzräume auch von den Befürworter*innen nicht abgetan werden sollte. Allerdings läuft die Debatte dabei Gefahr, mit dem Fokus auf Transgender die eigentliche Problematik aus dem Blick zu verlieren. Bereits in einem früheren Artikel wurde an dieser Stelle auf den Umstand hingewiesen, dass es eine schwierige, aber explizite Aufgabe der staatlichen Organe ist, zwischen den Bedürfnissen und Gefahren verschiedener Gruppen abzuwägen. Anders als bei öffentlichen Räumen müssen Gefängnisse ihre Insass*innen grundsätzlich auch vor Gewalttaten des eigenen Geschlechts schützen. Solange also keine dritte Gefängniskategorie existiert, geht also darum, Gefahren zu managen. Bei insgesamt 15 trans Straftäter*innen kann von der schottischen Justiz entsprechend erwartet werden, die Gefährdungsbeurteilungen im Einzelfall durchzuführen, auch um den Schutzbedarf von trans Gefangenen zu gewähren. Das bedeutet allerdings zu akzeptieren, dass es keine pauschale Lösung geben wird.