Woher kommt eigentlich der „Pride Month“?
8. Juni 2021Weiterlesen Pride Versammlungen sind in den mühsamen Geschichten unterdrückter Gruppen verwurzelt, die seit Jahrhunderten darum kämpfen von der Gesellschaft akzeptiert zu werden und Vorurteile zu überwinden. Warum im Juni? Die ursprünglichen Organisator*innen wählten diesen Monat, um die Stonewall-Aufstände im Juni 1969 in New York City zu ehren, welche unter anderem die moderne Gay Rights („Schwule/Lesbische Rechte“) Bewegung entfacht haben. Bei den Stonewall-Aufständen veranstaltete die Polizei in den frühen Stunden des 28. Junis eine Razzia in der Schwulenbar „Stonewall Inn“, und begann Kund*innen nach draußen zu schleppen. Als diese sich der Verhaftung widersetzten und eine Gruppe von Unbeteiligten begann, die Polizei mit Flaschen und Münzen zu bewerfen eskalierten die Spannungen schnell. New Yorks schwule und lesbische Community, die seit Jahren von der Polizei schikaniert worden war, brach in Nachbarschaftsaufständen aus, die drei Tage lang anhielten. So wurden sie zu einem Katalysator für aufstrebende Gay Rights Bewegungen, indem sich Organisationen wie die Gay Liberation Front und die Gay Activists Alliance formierten, modelliert nach der Bürgerrechtsbewegung und der Frauenrechtsbewegung. Mitglieder veranstalteten Proteste, trafen sich mit Politiker*innen und unterbrachen öffentliche Veranstaltungen um dieselben Politiker*innen zum Handeln zu bringen. Ein Jahr nach den Stonewall-Aufständen fanden in den USA die ersten Gay Pride Märsche statt. 2016 wurde der Bereich um das Stonewall-Inn als nationales Monument gekürt. Daher finden bis heute noch die meisten Pride Veranstaltungen im Juni statt, wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Im Jahr 2020 wurden viele dieser Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt, aber Umzüge und andere Feierlichkeiten werden dieses Jahr in Hamburg, Berlin, und vielen anderen Städten höchstwahrscheinlich wieder stattfinden. Woher kommt der Name und die Flagge? Der Name „Pride“ wird Brenda Howard, einer bisexuellen New Yorker Aktivistin zugeschrieben, deren Spitzname die „Mutter von Pride“ ist. Sie organisierte den ersten Pride Umzug, um dem Jahrestag des Stonewall-Aufstandes zu gedenken. Die Pride-Flagge wurde 1978 von dem Künstler und Designer Gilbert Baker entworfen, der von Harvey Milk – einem der ersten offen schwulen Politikern in den USA – beauftragt wurde eine Flagge für die Pride-Feiern zu entwerfen. Baker, ein prominenter Gay Rights Aktivist, orientierte sich dabei an den Streifen der US-Amerikanischen Flagge, nutzte jedoch die Farben des Regenbogens, um die vielen verschiedenen Gruppen innerhalb der Community zu reflektieren. Wer darf bei Pride mitfeiern? Pride wird von Menschen zelebriert, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht automatisch von der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft gefeiert wird. Weil Cis-Geschlechtlichkeit, hetero-Liebe, und hetero-Sex in der Mehrheitsgesellschaft als richtig gelten, und diese Orientierungen und Identitäten ständig in den Mainstream-Medien gezeigt werden, braucht es deshalb auch keinen „Straight Pride Month“ (Hetero-Stolz Monat). Das bedeutet jedoch nicht, dass Cis-hetero Menschen nicht auch als Verbündete an den Veranstaltungen teilnehmen können – indem sie Freund*innen begleiten und sie feiern, zuhören und lernen, oder sich bei einer Gruppe freiwillig engagieren.





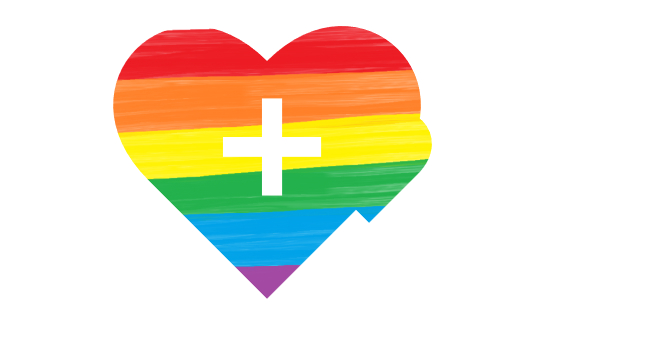

 (c) @AllOut[/caption]
(c) @AllOut[/caption] (c) @AllOut[/caption]
(c) @AllOut[/caption] (c) Frank Thies[/caption]
(c) Frank Thies[/caption]

