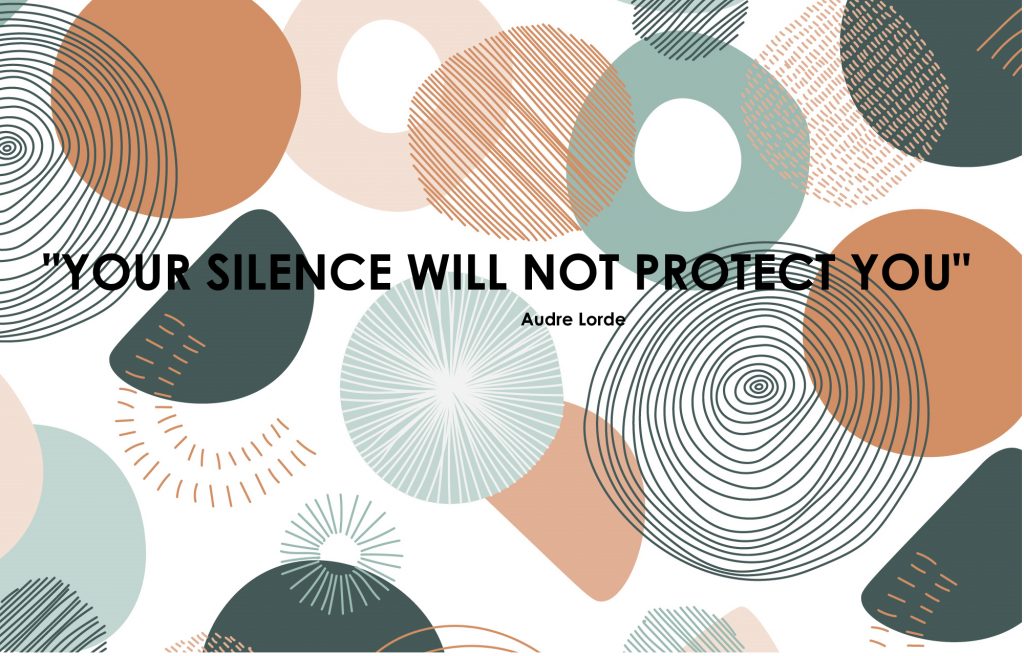Weiterlesen Unabhängig von der derzeitigen beruflichen Situation können sich die Teilnehmerinnen im Rahmen des Mentoringprogramms im regelmäßigen Austausch mit einer Mentorin* und in Gruppen Fragen zur beruflichen Situation widmen. Dabei können folgende Themen behandelt werden: Dabei geht es auch um Vernetzung und Austausch von Lesben* in unterschiedlichen Punkten ihres Berufswegs, Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie Unterstützung bei Diskriminierung am Arbeitsplatz. Das Mentoringprogramm L@work 2024 findet von Mai bis November statt. Nach der Auftaktveranstaltung am 04.05.2024 mit einem gegenseitigen Kennenlernen gibt es monatliche Treffen mit der Mentorin* sowie vier Gruppentermine. Zudem wird circa alle sechs Wochen zu einem Stammtisch eingeladen, an dem sich auch mit ehemaligen Teilnehmenden ausgetauscht werden kann. Weitere Informationen zu dem Mentoringprogramm und Anmeldung auf der Webseite von LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. Das Projekt „LeBe! Lesbisch im Beruf“ beschreibt sich folgendermaßen: „Mit unserem Projekt möchten wir uns im Sinne von sozialer Gerechtigkeit für eine Gesellschaft einsetzen, in der Lesben* in allen Facetten wertgeschätzt und akzeptiert werden. Wir möchten auch eine Sensibilität und Wahrnehmung dafür erreichen, dass Lesben* keine homogene Gruppe sind, sondern eine vielfältige Community dieser Gesellschaft mit unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Bedürfnissen. Wir verwenden bei der Beschreibung Lesbe* den sog. Gender-Star (Sternchen), um Mehrfachzugehörigkeiten und/oder unterschiedliche Haltungen gegenüber dem Begriff “Lesbe” sichtbar zu machen und die dominanten Vorstellungen von Gender zu benennen und als konstruiert zu kritisieren. Einfach gesagt, alle, die sich als Lesbe* begreifen, sind gemeint.“
Aufklärung und Bildung
Demonstrieren ist nur die halbe Miete
7. März 2024Weiterlesen Zu diesem Ergebnis kommt die „Mitte-Studie“ 2022/23 der Friedrich-Ebert-Stiftung. Fokus der Studie sind die rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen der Bevölkerung. Wie der Deutschlandfunk mit Bezug auf die Studie hervorhebt, zeigten mittlerweile mehr als acht Prozent ein offen rechtsextremes Weltbild. Gleichzeitig hätten „vor allem unter jungen Menschen […] die rechtsextremen Einstellungen zugenommen“. Ein Umstand, der bereits aus den spanischen Parlamentswahlen des vergangenen Jahres bekannt ist. Dort verzeichnet die rechtsextreme VOX die höchste Anzahl an Followern. Vor diesem Hintergrund sind die Demonstrationen gegen Rechts der vergangenen Wochen eine positive und längst überfällige Solidarisierung der Bevölkerung. Wenn also der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, betont, in diesem Jahr vermehrt ostdeutsche Veranstaltungen zum CSD besuchen zu wollen, wie beispielsweise in Pirna, wo ein AfD-Mitglied zum Oberbürgermeister gewählt wurde, dann ist dies nur zu befürworten. Es geht darum, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen und den Demagog*innen und Rechtspopulist*innen in der Öffentlichkeit entgegenzutreten. Laut einem Bericht der taz Berlin verwies Lehmann bei seiner Begründung auch auf die Correctiv-Recherchen zum Potsdamer Geheimtreffen von Rechtsextremist*innen mit Mitgliedern der Union und der AfD, bei dem sehr konkrete Pläne für eine Ausweisung von Millionen von Menschen geschmiedet wurden. Lehmann betonte, dass solche Pläne zur Einschränkung von Menschenrechten dabei immer alle beträfen, und rief zur Solidarität auf. Wer die Würde eines Menschen verteidigen will, muss die Würde aller verteidigen. Doch wird alles Demonstrieren und Solidarisieren vermutlich nicht ausreichen. Wie der Deutschlandfunk des Weiteren hervorhebt, sieht die Mitte-Studie vor allem Ereignisse wie Coronapandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation als Auslöser für das Gefühl der 'Entsicherung', das wiederum ein Aspekt für die zunehmende Empfänglichkeit rechter Gedanken darstellt. Allerdings vergisst diese Kausalkette einen Faktor, der auch bei den Protesten gegen Rechts kaum diskutiert wird: Die Marginalisierung durch Prekarisierung das heißt: Entwürdigung durch Armut. Zu ignorieren, dass die materiellen Unsicherheiten, die vor der eigenen Haustür reproduziert werden, keinen Effekt haben, ist bestenfalls zynisch. Zwei zentrale Entwicklungen, die diese 'Entsicherung' fördern, sind dabei die konkreten Vorschläge führender Politiker der Regierung zum Abbau des Sozialstaates, wie beispielsweise Christian Lindner nach einem Bericht der Zeit, die verschärfte Entsolidarisierung mit bereits marginalisierten Gruppen wie beim neuen EU-Asylverfahren und die zunehmende verbale Aufrüstung gegenüber Geflüchteten. Infolgedessen verzichten einige Menschen auf rechtlich legitime Leistungen aus Angst vor Stigmatisierung und Scham. „Der Staat spart dadurch zwar Milliarden, doch der Schaden ist groß“, so der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, in seiner Kolumne bei der Zeit. Wenn sich Institutionen, Vereine und Bürger*innen also gegen rechten Populismus und Polemisierung stellen wollen, ist Demonstrieren allein nicht ausreichend. Solidarisieren bedeutet darüber hinaus, die Ursachen im eigenen Garten zu benennen, und dazu zählt mindestens soziale Ungerechtigkeit und Marginalisierung durch Armut, die bekämpft werden müssen, um langfristig eine demokratische Gesellschaft zu erhalten.
Verhandlung über Anti-LGBTIQ* Gesetz in Ghana
5. März 2024Weiterlesen Die Diskriminierung und Kriminalisierung von LGBTIQ* findet in Ghana bereits seit Kolonialzeiten statt, homosexuelle Handlungen können mit Haftstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden. Laut Le Monde sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen dieses Gesetz tatsächlich angewendet wurde. Nun wird über ein weiteres Anti-LGBTIQ* Gesetz verhandelt, das noch drastischere Maßnahmen vorsieht. Vertreter*innen christlicher, muslimischer und traditioneller ghanaischer Gruppen haben die Legislatur vorangetrieben. Mit dem "Gesetz über menschliche sexuelle Rechte und ghanaische Familienwerte“ könnten jegliche Aktivitäten, die in Verbindung mit LGBTIQ* stehen, bestraft werden. LGBTIQ*-Kampagnen, die sich an Kinder richten, sollen sogar mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Das Nachrichtenportal Reuters beschreibt dies als eine der härtesten Anti-LGBTIQ* Gesetzgebungen auf dem afrikanischen Kontinent. Wie aus einem Bericht von Amnesty International Anfang dieses Jahres hervorgeht, gibt es einen Anstieg von homo- und queerfeindlichen Gesetzen in Afrika (echte-vielfalt berichtete). Sollte das Gesetz in Kraft treten, würden die Rechte der ghanaischen LGBTIQ* Gemeinschaft enorm verletzt, Diskriminierung befördert und ein feindseliges und womöglich gewaltvolles Klima gegenüber queeren Personen bestärkt werden. Außerdem würde auch die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Anti-AIDS Kampagnen damit beeinträchtigt werden, was katastrophale Folgen für das Land hätte. Denn der diskriminierungsfreie Zugang zu Diensten im Bereich HIV-Prävention sowie Tests und Behandlungen sei entscheidend, um die AIDS-Gefahr im Land abzubauen, so die UNAIDS Geschäftsführerin Winnie Byanyima in einem Statement. Aktivist*innen fordern Akufo-Addo dazu auf, den Gesetzesentwurf abzulehnen. Der Präsident äußerte zuvor, dass er ihm zustimmen würde, wenn die Mehrheit der ghanaischen Bevölkerung dies wünsche. Nun bleibt abzuwarten, ob Akufo-Addo dem Votum des Parlaments folgt oder ob die LGBTIQ*-Gemeinschaft aufatmen kann.
Amnesty International: Bericht zu Folgen des LGBTIQ*-feindlichen „Propaganda“-Gesetzes in Ungarn
29. Februar 2024Weiterlesen Mit der Verabschiedung des Gesetzes unter dem rechtspopulistischen Ministerpräsident Viktor Orbán sollte die Repräsentation queerer Lebensentwürfe in der öffentlichen Kommunikation, Bildung, Werbung oder den Medien drastisch eingeschränkt werden. Es gilt ein Verbot der „Darstellung und Förderung“ von „unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen“, ohne dass dies weiter erläutert würde. Insbesondere seit Anfang 2023 wird das Gesetz im großen Maße umgesetzt. Aus Angst vor Repressionen und Sanktionen würden viele bereits aufgehört haben, Informationen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu verbreiten. Dazu gehören Buchhandlungen, die eine Art Selbstzensur betreiben würden, um rechtliche oder finanzielle Folgen zu vermeiden. Viele Buchhandlungen, die Bücher mit queeren Inhalten vertrieben haben, wurden von den Behörden bereits sanktioniert, Auch zivilgesellschaftliche Organisationen bekommen durch das Gesetz immer mehr Schwierigkeiten, ihre Arbeit weiterzuführen. Vor allem für Kinder und Jugendliche sei der Zugang zu wichtigen Informationen rund um queere Themen blockiert. Amnesty International stellt in dem Bericht „From Freedom to Censorship: The Consequences of the Hungarian Propaganda Law“ fest, dass das Gesetz das queerfeindliche Klima im Land verstärke und vermehrt zu negativen Stereotypen und Diskriminierung gegenüber LGBTIQ* beigetragen habe. Laut der Menschenrechtsorganisation sei das Propaganda-Gesetz rechtswidrig. Es widerspreche dem Recht auf freie Meinungsäußerung, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention gesichert ist, von der Ungarn selbst Teil ist. Zudem würde das Recht auf Information, Recht auf Gleichheit und Nicht-Diskriminierung eingeschränkt werden. Das Gesetz könne nicht auf Basis des Schutzes von Kindern oder der öffentlichen Moral legitimiert werden, da die Rechte auf Information sowie Nicht-Diskriminierung hier dennoch wirken müssten. Shoura Hashemi, Geschäftsführerin bei Amnesty International Österreich, erklärt: „Amnesty International ruft die ungarische Regierung dringend dazu auf, das Propaganda-Gesetz aufzuheben und sicherzustellen, dass alle Personen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität, in Ungarn frei von Diskriminierung und Angst leben können.“ Aufgrund der Einschränkung von Rechten in Ungarn ist der Umgang mit dem osteuropäischen Staat schon länger ein konfliktreiches Thema in der Europäischen Union. Um ein klares Zeichen für den Schutz von LGBTIQ*-Rechten zu setzten, könnte die Union weitere Druckmittel gegen Ungarn einsetzen. Womöglich stößt der neu veröffentlichte Bericht von Amnesty International eine neue Debatte an.
Auf der Suche nach der Wahrheit über unsere sexuelle Orientierung – eine Programmempfehlung
27. Februar 2024Weiterlesen Das Format „42 - Die Antwort auf fast alles“ von arte geht in seiner kurzweiligen Episode „Sind wir alle bisexuell?“ genau dieser titelgebenden Frage nach und macht dabei deutlich, dass auch Homosexualität eine Schublade sein kann. Mit einem Blick auf Geschichte, Kultur und moderne Forschungsergebnisse wirft arte ein faszinierendes Licht auf dieses Thema und lädt dazu ein, unsere Vorstellungen von Liebe und Anziehungskraft neu zu überdenken. Bisexualität oder auch Pansexualität, die alle Geschlechter mit einschließt, findet dabei heutzutage in Filmen, Serien und der Kulturindustrie ganz selbstverständlich ihren Platz. In der Öffentlichkeit scheint sie hingegen immer noch auf Ressentiments und Schweigen zu treffen. Die Idee, dass der Mensch grundsätzlich fähig ist, sich zu allen Geschlechtern hingezogen zu fühlen, wirft somit eine spannende Debatte über die Biologie und Soziologie der menschlichen Sexualität auf. Dabei mach die Dokumentation deutlich, dass „Bi“ - entgegen dem Begriff - keine Frage des entweder-oder ist, sondern eher ein Spektrum, in dem sich Menschen bewusst oder unbewusst offen oder verdeckt entscheiden. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zugleich, dass die klaren Abgrenzungen von Sexualität, wie wir sie kennen und z.T. praktizieren, tief in die Abgründe der europäischen Geschichte führen. Mit Sicherheit lässt sich am Ende nur festhalten, dass es in der Sexualität kaum eindeutige Grenzen gibt, die nicht zuvor von Menschen festgelegt wurden. Mit dem Wissen um die Nähe von Sexualität und Identität: Eine Erkenntnis, die sowohl zur Selbstreflexion als auch zu einem nachvollziehbaren ersten Rückschrecken führen kann.
Weiterlesen In seiner Pressemitteilung betonte Buschmann: „Das neue Institut soll […] Menschen das Leben etwas leichter machen – aber niemandem etwas wegnehmen." Auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), sieht das Gesetz als Fortschritt für die LGBTIQ* Gemeinschaft. Gerade in den Fällen, in denen Menschen nach ihrem Outing den Rückhalt in der eigenen Familie verlieren, bietet das neue Gesetz die Möglichkeit, ihre Wahlfamilie auch rechtlich abzusichern, so Lehmann laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd). Aber auch für Ältere und Personen ohne Familie bietet das Gesetz diesen Rahmen. Voraussetzung der Verantwortungsgemeinschaft soll ein notariell beglaubigter Vertrag zwischen mindestens zwei und nicht mehr als sechs volljährigen Personen sein, die in einem tatsächlichen und überprüfbaren Näheverhältnis (z. B. WG oder Nachbarschaft etc.) stehen. Die Eckpunkte sehen dabei vier Modelle mit einem unterschiedlichen Grad der Verantwortungsübernahme vor. Buschmann erweiterte diese Liste bei seiner Vorstellung allerdings noch um eine sog. Grundstufe: 1: „Grundstufe“: Hier geht es darum, es den Vertragsparteien zu ermöglichen, als rechtliche Betreuer*in (§ 1816 BGB) oder in Fragen der Organspende (§ 8 des Transplantationsgesetzes) Berücksichtigung zu finden. 2: „Auskunft und Vertretung“: „[…] soll in einer gesundheitlichen Notsituation jeder Partner[in] der Verantwortungsgemeinschaft entsprechend dem Ehegattennotvertretungsrecht (§ 1358 BGB) Auskunft von behandelnden Ärzten verlangen und den oder die anderen Partnerin vertreten können“ 3: „Zusammenleben“: Partnerschaften, die zusammenleben, sollen unabhängig von ihrer gemeinsamen Wirtschaftsführung eine gegenseitige Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsführung erhalten. Die Einzelheiten sind vertraglich individuell zu regeln. Im Einzelfall soll geprüft werden, ob und welche Partner*innen eine Einstandsgemeinschaft entsprechend § 7 SGB II bilden. 4: „Pflege und Fürsorge“: Hierbei soll explizit „keine Verpflichtung zur Pflege“ geschaffen werden. Es soll vielmehr geprüft werden, ob Personen, die für andere einstehen, Ansprüche nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz haben (Beispiele wären hier Freistellung von Arbeit und finanzielle Unterstützung durch den Staat). 5: „Zugewinngemeinschaft“: Dieses soll die Gemeinschaft für den Fall eines Auseinanderbrechens absichern. Dabei sollen aber grundsätzlich keine Ansprüche nach Erb- oder Steuerrecht bestehen. Es wird jedoch geprüft, ob das Rentensplitting möglich ist. Wie zu erwarten, stößt der Entwurf dabei nicht nur auf Zustimmung. So weist die Oppositionspartei CDU nach Angaben des rnd darauf hin, dass solche notariellen Verträge bereits heute geschlossen werden können, ohne dass es dafür eines Gesetzes bedarf. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) macht, ebenfalls gegenüber dem rnd, deutlich, dass insbesondere Ältere, aber auch Pflegebedürftige und weitere Gruppen vor Vertragsmissbrauch geschützt werden müssten. Der Spiegel ergänzt die Befürchtungen, dass gerade Personen, die über lange Zeit unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt oder in der Kinderbetreuung übernehmen (meist Frauen), keine Ansprüche auf Unterhaltszahlungen entwickeln und die Verantwortungsgemeinschaft zudem jederzeit einseitig aufgelöst werden könne. Daraus folgt, dass vor allem die Punkte 3 bis 5 ein besonderes Augenmerk benötigen. Das gilt insbesondere für Personen, die bei Auflösung des Vertrags vor erheblichen Folgeproblemen stehen könnten und präventiv abgesichert werden müssen, um ihre Lebensperspektiven zu bewahren. Stichwort: Mangel an Unterhalt und/oder Rente, aber auch Hilflosigkeit, z. B. bei Älteren etc. In diesem Zusammenhang sollten gerade die großen Sozialverbände den Gesetzgeber daran erinnern, seinen Pflichten nach Art. 20 und 28 GG nachzukommen, die laut Deutschem Bundestag auch die soziale Absicherung beinhalten. Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Spardiskurses darf die Solidarität der Bürger*innen untereinander nicht als sozialstaatliche Sparmaßnahme missbraucht werden.
Literaturempfehlung: Audre Lorde – „Schwarze, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin, Kriegerin“
20. Februar 2024Weiterlesen Audre Lorde verfasste etliche Gedichte, Essays, Reden und Bücher, die Themen des Schwarzseins, Frau-Seins, Lesbisch-Seins gemeinsam auffassen. Ihre Werke haben Schwarzen Feminismus, intersektionalen Feminismus, queere Bewegungen und theoretische Strömungen wie die „Queer of Color Critique“ geprägt. Bis heute werden Lordes Worte in aktivistischen Kreisen wiederholt: „Your silence will not protect you“, [“Dein Schweigen wird dich nicht beschützen“] oder „The master’s tools will never dismantle the master’s house“ [„Die Werkzeuge des Herrn werden niemals das Haus des Herrn niederreißen“]. Ihre Biomythographie „Zami - Eine neue Schreibweise meines Namens“ erzählt von ihrer Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenendasein als lesbische Schwarze Frau in den USA: „Als Tochter karibischer Einwanderer wächst Audre Lorde im Harlem der vierziger Jahre heran. Eine Zeit, die sie eindrucksvoll und zutiefst poetisch heraufbeschwört. Ihre Erinnerungen sind geprägt von bedeutsamen Beziehungen zu Frauen – ihrer Mutter, Freundinnen, Geliebten –, von ihren Erfahrungen in der queeren New Yorker Subkultur, aber auch von schmerzhaften Momenten der Ausgrenzung. Wie in einem Bildungsroman entwirft Lorde in ihrem literarischen Hauptwerk ein Porträt der Künstlerin als junge Frau, erzählt die Geschichte einer Selbstfindung: vom hochbegabten Mädchen zur brillanten Schriftstellerin und zur „Schwarzen, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin, Kriegerin“. (Quelle: Hanser Literaturverlage) 2021 wurde ihre Essaysammlung „Sister Outsider“ ins Deutsche übersetzt. In 15 Essays, die zwischen 1976 und 1983 verfasst wurden, beschäftigt sich Audre Lorde auf verschiedene Arten und Weisen mit Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. Sie bricht dabei mit männlich-eurozentristischen Konzeptionen und stellt die diasporische Erfahrung Schwarzer Frauen in den Vordergrund. Lorde vertritt einen Feminismus, der Differenzen anerkennt, ohne sich auf ihnen zu versteifen, Koalitionen bildet und Solidarität erfordert. Sie stellt sich gegen Heteronormativität und die weiße Mehrheitsgesellschaft. Somit ist ihr Denken heute weiterhin von hoher Bedeutung. Ob ihre Essays, ihre Lyrik oder ihre Bio(mytho)graphie – eine große Empfehlung für ihre Werke wird hier ausgesprochen. Auch in Deutschland hat Lorde viele Menschen inspiriert, insbesondere in der afrodeutschen Frauenbewegung. Ab 1984 lehrte sie als Gastprofessorin für African American Literature und Creative Writing an der Freien Universität Berlin - bis zu ihrem frühzeitigen Tod aufgrund einer Krebserkrankung im Jahr 1992. Über ihre Zeit in Berlin gibt es den Film Audre Lorde – Die Berliner Jahre 1984-1992 von Dagmar Schultz. Bild (Muster) von Freepik
forbidden colours über die Abgründe von KI-Programmen: Handlungsbedarf für eine inklusive Zukunft
15. Februar 2024Weiterlesen Der Fokus liegt auf dem Effekt von „Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI)“. Darunter ist die gezielte Manipulation und Beeinflussung von Informationen durch ausländische Akteure zu verstehen, deren Ziel es ist, das öffentliche Meinungsbild auch international zu verändern oder politische, soziale oder kulturelle Spannungen zu schüren. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt vor einem Hintergrund zunehmender Diskussionen über die Rolle von KI und ihre potenziellen Auswirkungen auf demokratische Prozesse und die Rechte von Minderheiten. Insbesondere wird auf die Bedeutung von Algorithmen und Technologien hingewiesen, die nicht nur Miss- und Desinformation verbreiten, sondern auch Stereotypen verstärken und Diskriminierung fördern können. Damit betrachtet der Bericht ein Instrument und seine Mechanismen, die wir bereits in früheren Artikeln implizit wie explizit immer wieder zum Thema hatten. Zu nennen wäre hier u.a. die „Zunahme von Gesetzen gegen LGBTIQ* auf dem afrikanischen Kontinent“ sowie die „Ereignisse in Uganda“. Aber auch in Deutschland sind die potenziellen Nutzer*innen dieser Technologie keine unbekannten Randerscheinungen, wie ein Interview von „AfD-Experte Andreas Kemper über die Entwicklung der Partei & den Rechtsruck“ bei Jung und Naiv aufzeigt. Die Autor*innen des forbidden colours-Berichts, Megan Thomas und Meredith Veit, machen deutlich, wie KI strategisch eingesetzt wird, um durch Miss- und Desinformation soziale Spaltungen zu verschärfen und Hass gegen LGBTIQ* Personen zu schüren. Sie unterstreichen damit die Risiken, die durch KI-generierte Inhalte entstehen, darunter die Verbreitung voreingenommener Informationen an große Zielgruppen, was die Sicherheit und Rechte von LGBTIQ* Personen direkt bedroht. Die Folge ist eine Verschärfung von Vorurteilen durch KI-Algorithmen, die Verbreitung schädlicher Stereotypen und die Schaffung und Verbreitung von Anti-LGBTIQ* Erzählungen. Ein zentrales Beispiel ist die Aussage von Googles „Bard AI“ Chatbots zur Konversionstherapie, das die Gefahren von KI-generierten Ratschlägen bei der Fehlrepräsentation von LGBTIQ* Themen illustriert. Ein weiteres Beispiel ist das von Spotify verwendete Gender-Kategorisierungssystem, das neue "algorithmische Identität" formt. Die Folge ist die Verstärkung von Fehlern im Algorithmus und die daraus entstehende Diskriminierung gegenüber trans und nicht-binären Personen, indem sie ihre Identitäten in digitalen Räumen tendenziell auslöscht und diese Auslöschung normalisiert. In Anbetracht der aufgezeigten Mechanismen wird die Notwendigkeit einer politischen Diskussion zur Einführung von Rechtsgrundlagen und Regulierungen deutlich. Die Erkenntnisse von FIMI sowie die Verstärkung von Stereotypen und die Verbreitung von Fehlinformationen betreffen nicht nur spezifisch die LGBTIQ* Gemeinschaft, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf demokratische Prinzipien und einzelne Gruppen in der Gesellschaft. Diese führt zu einer Schnittmenge an Interessen, die politisch strategische Zusammenschlüsse von unterschiedlichen Akteuren ermöglicht, um der Frage nachzugehen: Wie kann und sollte KI rechtlich, aber auch gesellschaftlich eingehegt werden?
Safer Spaces für queere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Lübeck: Gruppentreffen von Lambda
13. Februar 2024Weiterlesen Jeden Mittwoch finden in Lübeck zwei Treffen für junge Queers statt. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ richtet sich an LGBTQIA* zwischen 12 und 16 Jahren und die „Rosa Einhorn Brigade“ an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren. Der Verein möchte Schutzräume für junge queere Personen schaffen, in denen Bildung, Austausch und Empowerment stattfinden kann. Unter Leitung der Sozialarbeiter*innen Julia Ostermann und Rebecca Herzberg haben die Gruppen einen monatlich wiederkehrenden Ablaufplan erarbeitet. Dabei wechseln die Termine wöchentlich zwischen Basteln, Spielen, gemeinsamem Kochen und Backen und Filmnachmittagen/-abende. Zudem wird einmal im Monat ein Thema besprochen, welches sich die Kinder und Jugendliche gewünscht haben, beispielsweise zum aktuellen politischen Geschehen. Im Schnitt nehmen an der Kinder- und Jugendgruppe Dino-Zug sechs Personen und an der Rosa Einhorn Brigade zehn Personen teil. Das Angebot sei aus vielen Gründen notwendig, betont Gruppenleiterin Julia Ostermann. Im Rahmen der Gruppentreffen und im Austausch mit anderen jungen queeren Personen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigene Identität in einem sicheren Rahmen zu erforschen und entfalten. So soll ein Safer Space geschaffen werden, was nach Angaben der Teilnehmenden auch gelingt. Eine*r der Jugendlichen hebt positiv hervor, dass in den Gruppen die Identität und Pronomen der Teilnehmenden stets respektiert werden und keine Diskriminierung stattfinde. „Ich gehe in die Jugendgruppe, weil ich einen Platz gesucht habe, wo ich komplett sein kann, ohne verurteilt zu werden“, so ein*e andere*r Teilnehmer*in. Der Austausch mit Personen, die die eigene Situation nachempfinden können, scheint für die Jugendlichen von hoher Bedeutung. Das Jugendnetzwerk schafft auch einen Ort, an dem soziale Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden können. Somit soll der Isolation von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt werden, was insbesondere bei jungen LGBTQIA* Personen ein Risiko sei. Auch bei Diskriminierung und Mobbing können die Gruppen die Betroffenen auffangen und unterstützen. Außerdem sollen die Gruppen Bildungs- und Aufklärungszwecke erfüllen: „Durch Workshops, Diskussionen und informative Veranstaltungen, wie z. B. unsere Thementage, können die Kinder und Jugendlichen ein tieferes Verständnis für ihre eigene Identität und die queere Community entwickeln“, so Ostermann. Von den Fachkräften bekommen die Teilnehmenden auch psychosoziale Unterstützung. Zudem bietet das Jugendnetzwerk lambda::nord mit der Beratungsstelle NaSowas auch konkrete Unterstützung bei Fragen rund um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität an. Die Kinder- und Jugendgruppe „Dino-Zug“ findet immer mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr statt, die Gruppe für ältere Teilnehmende „Rosa Einhorn Brigade“ mittwochs von 18:30 bis 21:00 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Jugendnetzwerks lambda::nord. Auf Instagram werden regelmäßig News und Termine zu den Treffen sowie anderen Angeboten des Vereins gepostet: @queere_jugendarbeit_hl
Konservatives Griechenland im Wandel: Herausforderungen und politische Strategien auf dem Weg zur Ehe für alle
9. Februar 2024Weiterlesen Nach Angaben von queer.de, die sich auf das griechische Parlament beziehen, wird die Abstimmung voraussichtlich am 14. oder 15. Februar stattfinden, wobei der Fraktionszwang für die Regierungspartei Nea Demokratia aufgehoben wird. Während sich der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gegen einen nicht kleinen Teil seiner eigenen Partei behaupten muss und sich auch die griechisch-orthodoxe Kirche offen gegen den Entwurf wendet, machte Mitsotakis deutlich, dass sich das Parlament die Bedenken der Kirche anhöre, aber die Legislative letztendlich beim Parlament liege, so queer.de weiter. Unterstützung kommt hingegen von der linken Oppositionspartei Syriza. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd), aber auch queer.de oder der Tagesspiegel und weitere berichten, hatte Parteichef Stefanos Kasselakis die Unterstützung seiner Partei für entsprechende Pläne der Mitte-Rechts-Regierung angekündigt. „Zwar gehe ihm der am Mittwoch [...] vorgestellte Vorschlag nicht weit genug, er enthalte aber ‚einige positive Elemente‘“(rnd). So soll das neue Gesetz diese Benachteiligung beenden und gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern ermöglichen. Bis dato fehlt laut rnd beispielsweise der Rechtsanspruch auf Besuch der Kinder im Krankheitsfall oder das Recht, das Kind der Partnerin*des Partners aufzunehmen, sollte dieser*diesem etwas zustoßen. Wie weitreichend die Problematik einer Nichtanerkennung der Elternschaft sein kann, hatten wir bereits anhand des EU-Gesetzesentwurfs zur automatischen Anerkennung der Elternschaft in allen EU-Staaten, der am 14. Dezember 2023 eingebracht wurde, beschrieben. Damals wiesen wir darauf hin, dass es allerdings nicht nur auf das Recht, sondern auch auf seine Anwendung ankomme. Dass Griechenland nun auch im nationalen Recht diesen Schritt geht, schafft daher (sollte das Gesetz verabschiedet werden) auf jeden Fall dort einen Rechtsanspruch. Die queere Community begrüßt den Gesetzentwurf, kritisiert jedoch, dass gleichgeschlechtlichen Paaren nach wie vor nicht erlaubt sei, ein Kind mit einer Leihmutter zu bekommen. Damit sind laut rnd Leihmutterschaften weiterhin nur für heterosexuelle Paare gestattet, wenn die Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht schwanger werden kann. Aus politstrategischer Sicht ist die Entkopplung der beiden Diskursfelder dabei möglicherweise gar nicht unklug gewählt. Indem man die Themen getrennt zur Disposition stellt, können politische Akteure möglicherweise breitere Unterstützung für die Ehe für alle gewinnen, ohne gleichzeitig kontroverse Fragen zur Leihmutterschaft zu berühren. Daraus darf allerdings keinesfalls folgen, dass das Thema der Leihmutterschaft unangetastet bleibt. Griechenland könnte das 16. der 27 EU-Mitgliedsstaaten werden, das die Ehe für alle öffnet. Es würde damit Estland folgen, das bereits am 20. Juni 2023 nach langem Ringen sein Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet hatte.