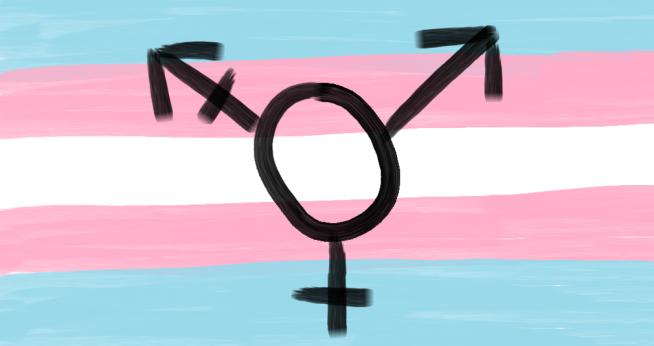EuroPride 2022: Ein Resümee
22. September 2022Weiterlesen Die Veranstalter*innen legten daraufhin Widerspruch ein, jedoch ließ das Innenministerium das Verbot bestehen. Es bestünden Sicherheitsbedenken aufgrund rechtsextremer Gegendemonstrationen, zitiert die ZEIT. Obwohl auch die Gegendemonstrationen verboten waren, kündigten einige der Gruppen an, sich nicht daran zu halten, so der Bericht weiter. Und doch fand am vergangenen Samstag eine – wenn auch verkürzte – Pride-Parade statt. Ana Brnabić, serbische Premierministerin, hatte nach Angaben von EPOA am Freitag die Veranstaltung bestätigt und ihre Sicherheit garantiert. Zu diesem Zweck waren zwischen 5.200 und 6.000 Polizist*innen im Einsatz gegenüber einer Teilnehmer*innenzahl von „an die Tausend“ nach Angaben des Spiegel u. a. Medien und bis zu 7.000 Teilnehmer*innen nach Angaben der Veranstalter*innen. Das Innenministerium sprach im Nachgang dennoch davon, dass das Verbot der EuroPride durchgesetzt worden sei. Es habe sich bei dem polizeilichen Einsatz lediglich um die „Eskorte der Menschen zu einem Konzert“ gehandelt, so die ZEIT weiter. Während die EuroPride wohl auch wegen des großen Polizeiaufgebots sicher verlief, kam es am Rande zu Zusammenstößen. Der „Freitag“ und die „Friedrich Neumann Stiftung“ berichten, dass nach offiziellen Angaben 64 Personen festgenommen und 13 Polizist*innen verletzt wurden. Unter den Opfern der Zusammenstöße befanden sich u. a. auch deutsche Journalist*innen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Rückweg ins Hotel, so der Tagesspiegel, dessen Journalistin Nadine Lange betroffen war. Dennoch wird die EuroPride von den EPOA als Erfolg gewertet. Hält man sich den internationalen und europäischen Druck vor Augen, wie auch die Teilnahme von Politiker*innen wie die des Queerbeauftragten der deutschen Bundesregierung, so zeigt sich, dass zivile und politische Mechanismen auch in Serbien noch wirken, obwohl sich die Regierung in letzter Zeit sehr nach rechts und zum ultrakonservativen Lager orientiert hatte. Gerade vor diesem Hintergrund bleibt allerdings offen, ob der Polizeischutz auch gewährleistet gewesen wäre, wenn sich keine internationalen Stimmen gegen Serbiens Regierung gerichtet und keine Vertreter*innen ausländischer Institutionen an der Parade teilgenommen hätten. Es ist ein ziviler Erfolg, der umso stärker wiegt, bedenkt man, dass im Vorfeld vonseiten der Gegner*innen sogar Waffengewalt ins Spiel gebracht wurde. Gleichzeitig wird klar, dass ein solcher Erfolg ein Zusammenspiel zwischen den gesellschaftlichen Akteur*innen erfordert. Demonstrationen und Veranstaltungen wie die EuroPride sind ein wichtiger Ausdruck, brauchen aber den Rückhalt der (inter-)nationalen Gemeinschaft, der hier deutlich wahrzunehmen war.