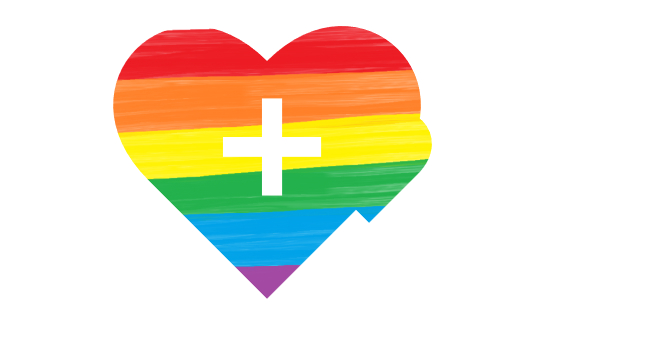Weiterlesen Wie die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) schreibt, beeinflusst allein der Anteil von Estrogen und Testosteron entscheidend das Immunsystem. Während Estrogen eher verstärkend wirkt, hat Testosteron den gegenteiligen Effekt. Frauen haben somit zwar ein stärkeres Immunsystem, gleichzeitig steigt bei ihnen allerdings auch das Risiko für Autoimmunerkrankungen. „Auch die Wahrnehmung von Schmerz und Nebenwirkungen bei Arzneimitteln, etwa solchen, die das Immunsystem beeinflussen, kann sich zwischen Frauen und Männern stark unterscheiden.“ Dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, ist auch außerhalb von Fachkreisen nicht unbekannt. Weniger bekannt ist allerdings, dass auch das soziale Geschlecht nicht nur einen Einfluss hat, sondern dass dieser Einfluss auch noch größer ist als beim biologischen Geschlecht. Wie Prof‘in Gertraud Stadler (Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung an der Charité Universitätsmedizin Berlin) gegenüber der DAZ erklärte, werden, obwohl die biologischen und sozialen Unterschiede zwischen Frauen und Männern belegt sind, Nebenwirkungen allerdings immer noch nicht geschlechterspezifisch erfasst. „Zugelassenen Dosierungen liegen in der Regel größtenteils Daten von Männern zugrunde. Selbst neue Wirkstoffe werden in der Regel zunächst an männlichen Versuchstieren untersucht, und in frühen Phasen klinischer Studien nur an jungen und gesunden Männern getestet.“ Aber nicht nur auf der Ebene von Wirkstoffen und Therapien spielt gendersensible Medizin eine wichtige Rolle. Wie der Wissenschaftspodcast der Zeitung Welt feststellt, ist ebenso der Umgang einer Person mit Krankheiten und Krankheitsrisiken sowie der Medikamenteneinnahme abhängig von den genderspezifisch erlernten Verhaltensmustern. Gendergerechte Medizin bedeutet also nicht nur eine differenziertere Forschung und darauf aufbauend adäquate Therapie und Medikationen, sondern beginnt bereits bei einer gendergerechten Kommunikation, um den unterschiedlichen Bedarfen und Verhaltensweisen seitens der Ärzt*innen, Apotheker*innen und anderen Fachpersonals professionell begegnen zu können.
Lebensbereiche
Gendergerechte Sprache: Eine Verlegenheitsdebatte?
12. Januar 2023Weiterlesen Jüngst äußerte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Angabe des SWR mit der Aussage: „Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr." Anders als es dieses Zitat suggeriert, haben Schulen jedoch in der Regel keine Wahl. Wie wir bereits im November berichteten, ist die deutsche Rechtschreibung für alle staatlichen Einrichtungen und damit auch für Schulen verpflichtend. Wenn Kretschmann, unterstützt von Teilen der CDU und FDP sowie dem Philologenverband Baden-Württemberg und anderen Bildungsverbänden, sich für einen genderfreien Deutschunterricht einsetzt, dann hat er das Recht auf seiner Seite. Folgt man allerdings seiner Argumentation weiter, so kommen Zweifel daran, ob mit der politischen Debatte ums Gendern nicht eine Strohpuppe entsteht, die das eigentliche Problem verschleiert. Der SWR zitiert weiter: „Es ist schon schlimm genug, dass so viele unserer Grundschüler nicht lesen können. Man muss es denen nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht." Dabei verkennt Kretschmann allerdings, dass Sprache fluide und stark vom sozialen und Bildungskontext abhängig ist. Dutzende Rechtschreibreformen sowie Jugendwörter und Anglizismen, die neu in den Duden aufgenommen werden, machen deutlich, dass das Problem nicht bei komplizierten Schreibweisen liegt. Ob man beim Sprechen über ein „…*innen“ stolpert, ist eine Frage des Trainings, so wie jede Lautkombination gelernt werden muss. Das, worauf es dabei ankommt, würden die Sozialwissenschaften als Habitus und Pfadabhängigkeit bezeichnen. Beim Habitus geht es darum, dass erlebte Handlungsmuster von der Person als selbstverständlich verinnerlicht werden. Auch Sprache und Ausdrucksweisen sind solche Handlungsmuster. Das bedeutet, was die Kinder in ihrem Umfeld als „normale“ Sprache erleben und was ihnen in der Schule beim Schreiben als „selbstverständliche“ Regeln vermittelt wird, wird irgendwann als „so ist das richtig“ hingenommen. Mit Pfadabhängigkeiten ist gemeint, dass für „selbstverständlich“ erachtete Sprache nicht ohne weiteres hinterfragt wird und sich damit als „Norm“ selbst bestätigt. Daraus folgt jedoch nicht die Unveränderlichkeit von Sprache. Im Gegenteil, wenn nicht in der Schule, wo sonst gäbe es einen Ort - begleitet durch fachliche Kompetenz - sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Das eigentliche Problem ist jedoch die genannte Schwierigkeit, die Schüler*innen beim Lesen haben. Das hat aber wohl weniger mit Gendern zu tun als vielmehr mit anderen Gründen außer- und innerhalb der Schule. in dem Fall sollte sich die Schule diesem Problem stellen und benötigt nicht das Weglassen von Sternen und Strichen, sondern eine bessere personelle Ausstattung bei kleineren Klassen. Bis dahin könnte der Vorschlag des Landesschülerbeirats zumindest eine Übergangslösung darstellen. Dieser fordere nach einem Bericht des Magazins queer: „Die Verwendung geschlechtergerechter Sprache in schriftlichen Prüfungen dürfe nicht mehr als Fehler gewertet werden.“ Alles andere „sei nicht mehr zeitgemäß“ so die Schüler*innen.
Gesucht: Queere Studienteilnehmende
10. Januar 2023Das Weihnachtsparadox der katholischen Kirche
9. Januar 2023Weiterlesen In seiner Weihnachtsansprache vom 25. Dezember 2022 verwies der Papst auf die symbolische Bedeutung, die Jesus als „hilfloses“ Baby habe und dass dies dazu ermahnen solle, denen zu helfen, die sich eben nicht selbst helfen können. Darunter könnte man auch verstehen, gerade jene Menschen aufzunehmen, die kein Teil des eigenen Selbstverständnisses sind, die aber gerade, weil sie sich als solche outen, als besonders schutzbedürftig dastehen. Und genau hier setzt die Paradoxie der Institution „katholische Kirche“ an. Wie wir bereits früher berichtet haben, ist im Vatikan vor allem auf höchster Ebene mit wenig Reformwillen in Bezug auf eine Änderung der offiziellen Sexuallehre zu rechnen. Doch das wäre nötig. Nun bleibt die katholische Kirche eine internationale Vereinigung mit eigenen Hierarchien, allerdings scheint es, dass zumindest in der jüngsten Berichterstattung immer wieder Funktionsträger auftauchen, die offen Kritik an den Praktiken und Haltungen ihrer Institution übten. Wie der NDR berichtet, erklärte sich zuletzt der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode enttäuscht vom Scheitern des Synodalen Wegs und machte deutlich, dass er mit weiteren Kirchenaustritten in seinem Bistum rechne. Auch schwulissimo griff diese Äußerung auf und betonte, dass ca. 80% der jungen Menschen in Deutschland nichts mehr mit der Kirche zu tun haben wollen. Hier zeigt sich, dass auch große internationale Organisationen auf ihre Mitglieder vor Ort angewiesen sind, um sich zu legitimieren. Vielleicht braucht es also keine Reform durch die Kirche in Rom. Beispiele zeigen, dass sich über die Zeit immer mehr lokale Enklaven und Bistümer sowie deren Funktionsträger (zumindest in Deutschland) damit konfrontiert sehen, den Wünschen und Erwartungen ihrer Gemeinde nachzukommen. Vielleicht wird sich die katholische Kirche am Ende zu einer dezentralen Struktur entwickeln, deren Bischöfe etc. mehr auf die Menschen vor Ort als auf eine veraltete und paradoxe Doktrin hören.
Disneys neuer Winterfilm mit schwulem Hauptprotagonisten: Eine progressive Entwicklung?
7. Januar 2023Weiterlesen Ähnlich sieht es auch bei LSBTIQ* Charakteren aus. Wie das Magazin queer aufzählt, waren sie meistens nur Randfiguren, die kurz auftauchen und dann wieder vergessen werden: „Ein schwules, verheiratetes Antilopen-Paar in "Zoomania", das erst bei genauem Lesen des Abspanns als solches zu erkennen ist, lesbische Elternpaare in "Findet Dorie" und "Toy Story 4", die ein paar Sekunden und ohne Dialog im Bild zu sehen waren. Viel mehr war da nicht.“ Im neuen Disney-Abenteuerfilm "Strange World" soll das Ganze anders sein: Der Film spielt im fiktiven Land Avalonia. Ausgangspunkt ist ein Bruch zwischen Claid und seinem Sohn Searcher während einer Entdeckungsreise. Der Sohn findet eine Pflanze, die das gesamte Energieproblem von Avalonia lösen kann und beschließt Farmer zu werden, während der Vater sich wieder auf Entdeckungstour begibt und verschwindet. 25 Jahre später ist Searcher ein erfolgreicher Farmer, der mit seiner Frau Meridian und seinem eigenen Sohn Ethan auf einer Farm lebt. Aber natürlich gibt es ein Problem. Eines Tages landet die Präsidentin von Avalonia auf der Farm und eröffnet Searcher, dass die Pflanze nicht mehr genügend Energie liefere. So machen sich Searcher und Ethan auf in ein eigenes Abenteuer, um das Problem zu lösen. Waren es bis jetzt Nebenrollen, so haben wir mit Ethan das erste Mal explizit einen Hauptcharakter, von dem wir erfahren, dass er in einen Freund aus seiner Clique verliebt ist. Queer schreibt dazu: „Dass dieser Jemand ein Junge namens Diazo ist, ist erfreulicherweise nicht das geringste Problem für Ethans Eltern. Und auch für sonst niemanden in "Strange World", schließlich geht es hier nicht um ein Coming-out, sondern um ein großes, gefährliches Abenteuer.“ Es ist also eine Hauptfigur mit normalen Teenagerproblemen wie Verliebtsein, ohne dass dabei die Sexualität zum Problem wird. Doch ist das tatsächlich der Fall. In seiner Filmanalyse bemerkt der Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt, dass gerade das Überzeichnete, mit dem Disney betont, dass niemand ein Problem damit habe, dass Ethan schwul sei und „wie selbstverständlich doch diese Selbstverständlichkeit ist“, die Frage aufwirft: Was steckt dahinter? Gerade bei Disney gilt es hier genau hinzuschauen. Wie Schmitt weiter bemerkt, lässt sich zwischen Ethan und seinem Schwarm Diazo keine einzige romantische Szene finden und auch sonst taucht Diazo nur für einige Minuten auf, um dann, wie schon die Nebencharaktere vor ihm, in der Versenkung zu verschwinden. Natürlich kann genau dies beabsichtigt sein, dass die Beziehung ohne weitere Romantisierung selbstverständlich im Hintergrund wirkt. Wäre es dann allerdings nicht viel selbstverständlicher gewesen, die beiden Jungen wären sich nähergekommen, ohne dass sich eines der Elternteile dazu genötigt gesehen hätte, das wortreich zu kommentieren? Nur weil etwas als selbstverständlich geäußert wird, steht dahinter noch lange keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr wirkt das Ganze, als wollen sich die Erwachsenen selbst überzeugen. Die Folge muss deshalb natürlich kein Boykott von Disneyfilmen sein, jedoch kann es nicht schaden, wie auch bei anderen Filmen, etwas genauer hinzusehen und sich nicht vom erstbesten Narrativ überzeugen zu lassen.
Ist das Gleichbehandlungsgesetz ein zahnloser Tiger?
6. Januar 2023Weiterlesen Wie die ZEIT mit einem Verweis auf den Berliner Tagesspiegel zitiert, bezeichnete Ataman das Gesetz als „leider zahnlos“. Die ZEIT berichtet weiter, dass das Problem nach Ataman vor allem in dem Umstand liege, dass staatliches Handeln vom Anwendungsbereich des AGG ausgenommen sei. „Das bedeute, dass sich all jene, die zum Beispiel im Jobcenter oder am Bahnhof von der Bundespolizei diskriminiert würden, nicht darauf berufen könnten.“ Zwar ist nach Art. 3 GG auch dem Staat und seinen Organen jegliche Diskriminierung untersagt, allerdings wird dies nicht konkret durch das AGG geregelt. Im aktuellen Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle wurden für 2021 insgesamt 5.617 Fälle gemeldet, die mit einem der im AGG genannten Diskriminierungsgründe zusammenhingen, zwanzig Prozent davon im Zusammenhang mit dem Geschlecht und immer noch vier Prozent (225 Fälle) mit sexueller Identität. Hier ist darauf hinzuweisen, dass es sich explizit um eine Meldestatistik handelt und somit keine Rückschlüsse auf Dunkelziffern und oder Unterkategorien zu ziehen sind. Wie sowohl ZEIT als auch queer berichten, betonte Ataman im Besonderen das Nichtvorhandensein eines Diskriminierungsschutzes aufgrund des sozialen Status. Ein geringer Sozialstatus bedeutet letztendlich nichts weniger als geringe monetäre und andere Ressourcen wie bspw. auch Bildung. Während sich Menschen mit guter Bildung und genügend Geld bei Diskriminierung zumindest einen Rechtsbeistand leisten können oder um ihre Rechte wissen, stehen Menschen, die von Armut bedroht sind und eine geringe Bildung haben, häufig vor einer doppelten Diskriminierung. Auch die LGBTQ* Gemeinschaft ist nicht davor gefeit, dass es Menschen in ihrer Mitte gibt, die unter solchen Schwierigkeiten leiden. Ob es Ferda Ataman allerdings gelingt, ihre hohen Ziele auch tatsächlich umzusetzen oder ob am Ende nur ein weiterer „zahnloser Tiger“ zwischen den Paragrafen steht, bleibt abzuwarten.
Weiterlesen Mit der Broschüre „Divers und jetzt?!“ versuchen die Landeskoordinationen Inter* in Niedersachsen und NRW den Verantwortlichen für genau diese Situationen ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie QNN schreibt. Aber auch für Personaler*innen, die sich bereits mit dem Thema befasst haben, kann die Publikation als Checkliste beim Qualitätsmanagement Verwendung finden. Neben einer Auswahl an weiterführender Literatur bietet die Broschüre eine Liste von Anlaufstellen bei Fragen zum Thema. Zwei der vier Stellen sind dabei auch bundesweit aktiv und bieten einen Service über Niedersachsen und NRW hinaus. Hinzu kommen eine kurze und allgemeine Begriffserklärung, was Inter*-Sein bedeutet sowie bedingte Rechtsgrundlagen. Abschließend finden sich zwei konkrete Checklisten, die für Bewerbungsverfahren, aber auch die Gestaltung des Arbeitstags konkrete Orientierungspunkte liefern können. Natürlich ist auch eine Broschüre kein Allheilmittel, aber es kann für viele Menschen hilfreich sein, sich zu informieren und Anhaltspunkte zu finden. Das gilt allerdings nicht nur für die Personalabteilung. Auch der Betriebsrat oder die interne Revision können die Checklisten nutzen, um sich mit ganz konkreten Vorschlägen für ein besseres Arbeitsklima einzusetzen. Für Unternehmen, die schon eine etablierte inter* bzw. diverse* Arbeitskultur und eigene Tools und Kontrollmechanismen haben, mag die Broschüre allerdings nichts Neues mehr bieten. Sie ist daher eher als „Kick-Start“ zu verstehen, um es Arbeitgeber*innen und Personaler*innen zu ermöglichen, in eine weniger diskriminierende Arbeitskultur einzusteigen. Bei Interesse kann die Broschüre unter inter@qnn.de bestellt werden oder einfach hier als PDF kostenlos heruntergeladen werden.
Strengere Ahndung von Hasstaten gegen queere Menschen
30. Dezember 2022Weiterlesen Das „Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“, so der vollständige Name, verweist unter Punkt III. im Besonderen auf § 46 Absatz 2 StGB. Dieser benennt die Umstände, die bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. Dabei sind menschenverachtende Beweggründe bzw. Ziele besonders in Augenschein zu nehmen. Bis jetzt waren hier Punkte wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgeführt. Der neue Entwurf erweitert diese Liste um die Tatmotive „geschlechtsspezifisch“ und „gegen die sexuelle Orientierung gerichtet“. „Der Begriff „geschlechtsspezifisch“ soll dabei nicht nur die unmittelbar auf Hass gegen Menschen eines bestimmten Geschlechts beruhenden Beweggründe erfassen, sondern auch die Fälle einbeziehen, in denen die Tat handlungsleitend von Vorstellungen geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit geprägt ist.“ Der Text führt hierzu das Beispiel eines „patriarchalen Besitzanspruches“ eines „Täter[s] gegenüber seiner Partnerin oder Ex-Partnerin“ an. Hier muss – um Missbrauch für rechte Zwecke zu vermeiden - darauf aufmerksam gemacht werden, dass patriarchales Denken und Handeln in allen Schichten und kulturellen Hintergründen existiert. Während sich der erste Begriff vor allem auf Hass gegen Frauen bezieht, richtet sich der zweite Tatbestand deutlicher an Verbrechen gegen LSBTIQ* Personen: „Die ausdrückliche Nennung der „gegen die sexuelle Orientierung gerichteten“ Tatmotive betont die Notwendigkeit einer angemessenen Strafzumessung für alle Taten, die sich gegen LSBTI-Personen richten.“ Auf der offiziellen Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMSFSJ) bemerkt Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: „[…] Was Schwarz auf Weiß im Gesetzestext steht, findet in der Rechtspraxis mehr Beachtung. Die ausdrückliche Erwähnung dieser Beweggründe unterstreicht zudem, dass die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen schon frühzeitig solche Motive aufzuklären und zu berücksichtigen hat.“ Für Menschen, die Opfer solcher Taten geworden sind, bedeutet das zumindest in der Theorie, dass ihnen schneller Gehör geschenkt werden sollte, um somit mögliche blinde Flecken eher zu vermeiden. Es gilt allerdings zu bedenken, dass wir uns mit diesem Gesetz am äußersten Ende der Eskalation bewegen. Es bedeutet nämlich, dass ein Hassverbrechen bereits im Raum steht. Gerade der Begriff des „Patriarchalen“ macht deutlich, dass es sich bei solchen Taten immer auch um „Phänomene“ einer Sozialisation handelt, die nicht in einem luftleeren Raum entstehen, sondern Ergebnis von Strukturen und Erziehung sind. Der neue Entwurf betrifft daher nur eine Seite der Medaille, die ohne eine parallele zivilgesellschaftliche Veränderung nur Symptombekämpfung bleibt.
Keine politischen Botschaften ohne Genehmigung
27. Dezember 2022Weiterlesen Unter dem Dach der FiA finden beispielsweise Sportveranstaltungen wie die Formel 1 statt. Die Statuten bilden also das zentrale Regelwerk für die großen Veranstaltungen des Motorsports. So gilt laut Artikel 12.2.1.n, der ab 2023 in Kraft tritt, „die allgemeine Abgabe und Veröffentlichung von politischen, religiösen und persönlichen Äußerungen oder Kommentaren, die insbesondere gegen den allgemeinen Grundsatz der Neutralität verstoßen, der von der FIA im Rahmen ihrer Statuten gefördert wird, […]“, als Regelverstoß, solange vorab keine Genehmigung eingeholt wurde. Wie das Magazin queer berichtet, verweisen die FiA Funktionär*innen in ihrer Begründung auf den Ethikkodex des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der in Artikel 1.2 die „Universalität und politische Neutralität der olympischen Bewegung“ als Grundsatz festlegt. Jedoch ist eine „politische Neutralität“ nichts als eine Farce. Eventuell hätte man die Neutralität als Versuch annehmen können, wenn politische Botschaften allgemein erlaubt wären, solange sie nicht gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verstoßen, die ebenfalls einen Anspruch auf Universalität erhebt. Allerdings wird mit jedem unkommentierten Ereignis von Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung und anderen „politischen Handlungen“ keine Neutralität, sondern eine Legitimierung des Status Quo an die Fangemeinde signalisiert. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Funktionär*innen des FiA ihrer politischen Tragweite nicht bewusst wären. Im Gegenteil berichtet queer, „der Verband [habe] seit Anfang 2020 auch auf Betreiben von Fahrer*innen um Lewis Hamilton Gesten zur Unterstützung des Kampfs gegen Rassismus gestattet.“ Dennoch erhielt Hamilton nach Angeben der Deutschlandfunk eine Verwarnung, nachdem er auf dem Podium ein Shirt mit der Aufschrift „Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben“ getragen hatte. Hamilton erinnerte dabei, so der Sender, an die schwarze US-Amerikanerin, die bei einem Polizeieinsatz in ihrem Haus erschossen worden war. Ein Jahr später wurde Sebastian Vettel, der sich 2021 mit einem „Same Love“-T-Shirt für die Rechte der LGBTQ* Gemeinschaft eingesetzt hatte, von der FiA verwarnt. Es wäre naiv zu glauben, internationaler Spitzensport sei eine unpolitische Angelegenheit. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es Verbänden wie der FiA vor allem um ein geschäftsfähiges Image geht.
Neues aus den USA: Präsident Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen
23. Dezember 2022Weiterlesen Nach einem Zitat des Guardian betonte Biden in seiner Rede vor der Unterzeichnung, wie lange es gedauert habe und wie wichtig das Durchhaltevermögen derer gewesen sei, die immer an ein entsprechendes Gesetz geglaubt haben. Wie lang das wirklich war, macht eine Studie des Meinungsforschungsinstitutes GALLUP deutlich. Demnach lag noch 2004 die Zustimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe bei 42 %. Im Jahr 2022, also 18 Jahre später, stieg die Zustimmung auf 71 %. Die Studie zeigt zum Beispiel auch, dass der Anteil der Befragten, die wöchentlich die Kirche besuchen, besonders wenig Zustimmung aufwies (2004: 20 %). Im Jahr 2022 hat sich allerdings auch in dieser Gruppe die Zustimmung auf 40 % verdoppelt. Es lässt sich somit festhalten, dass die Haltung in den USA in diesem Bereich einen durchweg positiven Wandel durchlaufen hat. Wie wir allerdings bereits in unserem Artikel zur Verabschiedung des Gesetzes im Senat angemerkt hatten, ist mit dessen Eintreten zwar ein Ergebnis, aber noch kein Ende des Diskurses erreicht. Laut Forbes ist mit Gegenklagen zu rechnen, die in einem momentan sehr konservativen „Supreme Court“ durchaus Gehör finden könnten. In älteren Urteilen hatte sich der Oberste Gerichtshof der USA allerdings bereits unterstützend den Rechten einer nicht gleichgeschlechtlichen Ehe gegenüber verhalten. Auf der Webseite des US-Kongresses wird in einer Stellungnahme zum Gleichstellungsgesetz deshalb immer wieder auf entsprechende Urteile verwiesen. Zweck des Gesetzes ist es letztendlich, das Bundesrecht dahingehend anzupassen, dass jeder Wortlaut der Ehe als Vorgang zwischen „Mann und Frau“ durch „zwischen zwei Personen“ ersetzt wird. Ein entsprechendes Urteil des Supreme Court gab es bereits 2013. Weiter werden alle Klauseln, die nicht zwingend verlangen, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen, durch die Pflicht zur vollumfänglichen Anerkennung der Ehen und der daraus resultierenden Rechtsansprüche ersetzt. Auch hier hatte der Supreme Court bereits 2015 auf die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen hingewiesen, die gleichgeschlechtliche Ehen verbieten. Mit dem jetzt unterzeichneten Gesetz haben nun nicht nur die Betroffenen, sondern auch das Justizministerium die Möglichkeit, bei Verstößen Klage einzureichen. Einschränkungen in der Reichweite bestehen hingegen in Bezug auf die religiöse Freiheit und den Gewissensschutz und damit verbundene Dienstleistungen. Damit ist keine Institution dazu verpflichtet, eine Ehe zu vollziehen. Ebenso betrifft das Gesetz keine Vorteile oder Rechte, die sich nicht aus einer Ehe ergeben. Wie sich das ganze weiterentwickelt, muss nun die Praxis zeigen.