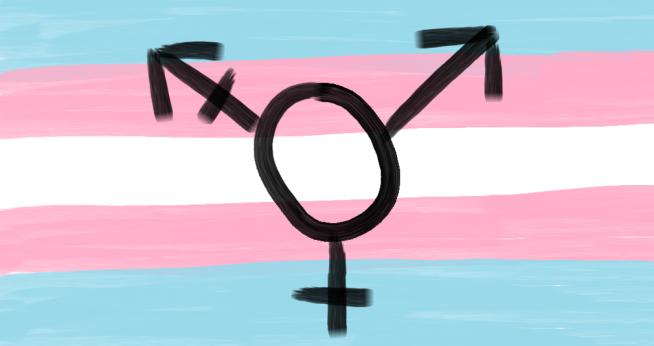Weiterlesen Wie die BBC berichtet hat nun die Fidesz-Partei einen Gesetzentwurf eingereicht, welches das Verbot gewisser Inhalte generell ermöglichen soll. Die beträfe vor allem Inhalte, die bei Minderjährigen für Homosexualität und Geschlechtstransitionen „werben“. Der Entwurf würde LSBTIQ*-Literatur, inklusive Bildungsmaterial, für unter-18-jährige verbieten. Er besagt, dass jungen Menschen unter 18 keinerlei Inhalte gezeigt werden dürfen, die Queerness „unterstützen“, und ist dabei in einer Regierungsvorlage enthalten, die Pädophilie bestraft. So werden Homosexualität und nicht-konforme Geschlechtsidentitäten institutionell pathologisiert, während die ungarische Verfassung propagiert, dass die Ehe für hetero-Paare ist, und Adoption für homo-Paare unterbindet. Einige Menschenrechtsorganisationen haben dieses Vorgehen bereits kritisiert und es mit den russischen Restriktionen von LSBTIQ*-Aktivitäten verglichen. Die Fidesz-Regierung (wie Polens PiS-Regierung) steht für den Vorwurf mehrfacher Brüche von EU-Rechtsstaatlichkeits-Standards unter formaler EU-Investigation. Gleichzeitig läuft sich Orbans Fidesz-Partei gerade für die ungarischen Wahlen Anfang 2022 warm. Obwohl Orban von der EU als tolerant gegenüber Antisemitismus, für die Einschränkung der Rechte von Migrant*innen und anderer Minderheiten, und für die Politisierung der Gerichte und Medien kritisiert wird, wird der euroskeptische Nationalist seit 2010 mit einer großen Mehrheit wiedergewählt. Er behauptet dabei Ungarns christliche Werte gegen ein vom linkem Liberalismus dominierten Europa zu verteidigen. So bleibt Fidesz die stärkste Kraft im ungarischen Parlament und in den Medien – eine neue Oppositionskoalition fasst jedoch laut Meinungsforschung Fuß. Außerdem werden auch verschiedene ungarische LSBTIQ*-Gruppen wie die Hatter Society laut gegen Fidesz‘ Entwurf und prangerten an, dass er „die Meinungsfreiheit und Kinderrechte schwerwiegend einschränken würde“. Budapest Pride, eine Allianz verschiedener Ungarischer LSBTIQ*-Gruppen, drängte Aktivist*innen den US-Präsidenten Joe Biden zu beeinflussen, die Angelegenheit nächste Woche bei seinem Besuch bei Orban zu thematisieren. Und mit der Bewusstsein des Privilegs, in Deutschland problemlos dafür werben und darüber sprechen zu können, finden Sie hier fünf queere Buchempfehlungen für Kinder.
Beratung und Recht
Weiterlesen Die Polizei meldete der Hauptstadt am Sonntag, dass die jugendlichen Frauen zunächst homofeindlich beleidigt und diskriminiert, und anschließend brutal geschlagen wurden. Wie queer.de berichtete, hielten sich die jungen Frauen gerade im Park am Gleisdreieck auf, als die drei unbekannten Täter*innen auf sie zukamen, mit Fäusten auf sie einschlugen und nach ihnen traten. Die 14-Jährige erlitt hierbei Verletzungen an den Rippen und am Rücken, ihre Begleiterin im Gesicht und am Hinterkopf. Bevor die Schläger*innen sich vom Tatort entfernten, entrissen sie der 14-Jährigen die Handtasche mit Portemonnaie und Handy, wobei letzteres mutwillig beschädigt wurde. Anschließend erstatteten die beiden verletzten Jugendlichen auf einem Polizeiabschnitt Anzeige gegen Unbekannt und haben vor, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Wie bei Hasskriminalität üblich, führt der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen des homophoben Übergriffs, nähere Angaben zu den drei Angreifer*innen wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Weil Hassverbrechen aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Berliner Polizei gezielt publiziert werden, werden diese vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit gemeldet. Nach wie vor besteht hier allerdings eine große Dunkelziffer, nicht nur was körperliche, sondern auch verbale Angriffe anbelangt. Weil es jedoch sehr wichtig ist, dass diese Verbrechen sichtbar und geahndet werden, gibt es bei der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft eigene Ansprechstellen für LGBTI. Unterstrichen wird dies mit der Aussage: „Nehmen Sie Gewalt und Diskriminierung nicht hin! Holen Sie sich Unterstützung! Erstatten Sie Anzeige!“. Erfahren Sie hier mehr über eine Untersuchung zu lesbenfeindlicher Gewalt in Berlin.
Woher kommt eigentlich der „Pride Month“?
8. Juni 2021Weiterlesen Pride Versammlungen sind in den mühsamen Geschichten unterdrückter Gruppen verwurzelt, die seit Jahrhunderten darum kämpfen von der Gesellschaft akzeptiert zu werden und Vorurteile zu überwinden. Warum im Juni? Die ursprünglichen Organisator*innen wählten diesen Monat, um die Stonewall-Aufstände im Juni 1969 in New York City zu ehren, welche unter anderem die moderne Gay Rights („Schwule/Lesbische Rechte“) Bewegung entfacht haben. Bei den Stonewall-Aufständen veranstaltete die Polizei in den frühen Stunden des 28. Junis eine Razzia in der Schwulenbar „Stonewall Inn“, und begann Kund*innen nach draußen zu schleppen. Als diese sich der Verhaftung widersetzten und eine Gruppe von Unbeteiligten begann, die Polizei mit Flaschen und Münzen zu bewerfen eskalierten die Spannungen schnell. New Yorks schwule und lesbische Community, die seit Jahren von der Polizei schikaniert worden war, brach in Nachbarschaftsaufständen aus, die drei Tage lang anhielten. So wurden sie zu einem Katalysator für aufstrebende Gay Rights Bewegungen, indem sich Organisationen wie die Gay Liberation Front und die Gay Activists Alliance formierten, modelliert nach der Bürgerrechtsbewegung und der Frauenrechtsbewegung. Mitglieder veranstalteten Proteste, trafen sich mit Politiker*innen und unterbrachen öffentliche Veranstaltungen um dieselben Politiker*innen zum Handeln zu bringen. Ein Jahr nach den Stonewall-Aufständen fanden in den USA die ersten Gay Pride Märsche statt. 2016 wurde der Bereich um das Stonewall-Inn als nationales Monument gekürt. Daher finden bis heute noch die meisten Pride Veranstaltungen im Juni statt, wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Im Jahr 2020 wurden viele dieser Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt, aber Umzüge und andere Feierlichkeiten werden dieses Jahr in Hamburg, Berlin, und vielen anderen Städten höchstwahrscheinlich wieder stattfinden. Woher kommt der Name und die Flagge? Der Name „Pride“ wird Brenda Howard, einer bisexuellen New Yorker Aktivistin zugeschrieben, deren Spitzname die „Mutter von Pride“ ist. Sie organisierte den ersten Pride Umzug, um dem Jahrestag des Stonewall-Aufstandes zu gedenken. Die Pride-Flagge wurde 1978 von dem Künstler und Designer Gilbert Baker entworfen, der von Harvey Milk – einem der ersten offen schwulen Politikern in den USA – beauftragt wurde eine Flagge für die Pride-Feiern zu entwerfen. Baker, ein prominenter Gay Rights Aktivist, orientierte sich dabei an den Streifen der US-Amerikanischen Flagge, nutzte jedoch die Farben des Regenbogens, um die vielen verschiedenen Gruppen innerhalb der Community zu reflektieren. Wer darf bei Pride mitfeiern? Pride wird von Menschen zelebriert, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht automatisch von der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft gefeiert wird. Weil Cis-Geschlechtlichkeit, hetero-Liebe, und hetero-Sex in der Mehrheitsgesellschaft als richtig gelten, und diese Orientierungen und Identitäten ständig in den Mainstream-Medien gezeigt werden, braucht es deshalb auch keinen „Straight Pride Month“ (Hetero-Stolz Monat). Das bedeutet jedoch nicht, dass Cis-hetero Menschen nicht auch als Verbündete an den Veranstaltungen teilnehmen können – indem sie Freund*innen begleiten und sie feiern, zuhören und lernen, oder sich bei einer Gruppe freiwillig engagieren.
Weiterlesen Denn noch immer sind trans Personen in Deutschland gezwungen, sich einer langen und teuren „Begutachtung“ auszusetzen, um ihr legales Geschlecht zu verändern. Dieser Prozess sei, so beschreibt trans Aktivistin Felicia Rolletschke im Gespräch mit der Deutschen Welle, „degradierend, teuer, und unlogisch“. Sie gehört deswegen zu den vielen Aktivist*innen, die für eine Reform des sogenannten „Transsexuellengesetzes“ kämpfen, welches den gesetzlichen Geschlechts- und Namensänderungs-Prozess für trans Personen festlegt. Während dieses nun seit vierzig Jahren in Kraft ist, haben sich trans Gesetze in anderen Ländern langsam modernisiert – sogar das Deutsche Bundesverfassungsgericht selbst hat bereits mehrmals eine Veränderung empfohlen, zuletzt im Jahr 2011. Nun hat die Regierung jedoch deutlich gemacht, dass mit solch einer Reform erstmal nicht gerechnet werden kann. Dies hält trans Personen zurück, denn wie Rolletschke erklärt, ist es wirklich ein großer Aufwand und eine Last, den gesetzlichen Namens- und Geschlechtseintrag zu ändern – sie selbst durchlief den Prozess zwischen 2015 und 2018. Als sie im Rahmen ihrer damaligen Therapie entschied, ihren Namen zu verändern, musste sie 1600 Euro bezahlen, um den Prozess überhaupt beginnen zu können. Dieser Betrag stellt oft eine Barriere für trans Personen dar, gerade für jüngere ohne eigenes Einkommen. „Es sollte keine Voraussetzung sein, genug Geld rumliegen zu haben, um deinen gesetzlichen Namen zu verändern“. So Rolletschke. Laut Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* (BVT) ist dies jedoch eine typische Summe: „Wir sehen oft Kosten von mehreren tausend Euro“ – „Das sind viel zu hohe Hürden“. Nach der ursprünglichen Anhörung durch eine*n Richter*in wird das Geld benötigt, um für zwei "Expert*innen-Gutachten“ (meistens durch staatlich anerkannte Psychotherapeut*innen) zu bezahlen, die unabhängig die betroffene Person „begutachten“. Rolletschke beschrieb ihre Erfahrung dessen als größtenteils basierend auf „altmodischen Geschlechterrollen“. Sie erzählte, dass beide Gutachten je zwei Stunden dauerten und ihre ganze Lebensgeschichte abdeckten: „Sie fragen nach sexuellen Erfahrungen, sexueller Orientierung, Fetischen, Familienstrukturen. Es ging um viele Themen die für Geschlecht gar nicht relevant sind.“ Außerdem bekam sie als trans Frau den Eindruck, auf Basis ihrer Konformität mit einer „stereotypisch weiblichen Erscheinung“ beurteilt zu werden: „Sie beurteilten wie gut mein Make-Up aufgetragen war. Auch, ob ich meine Beine verschränkte, wenn ich mich hinsetzte. Und sie beurteilten meine sexuelle Orientierung. Zum Beispiel, wenn du eine trans Frau bist, und nur an Männern interessiert bist, gibt das Bonus Punkte“. Am Ende schicken die Therapeut*innen ihr Gutachten an den*die jeweilige Richter*in – und laut Hümpfner kommen sie in 99% der Fälle zum gleichen Schluss wie die betroffene trans Person selbst: „Damit sind [die Gutachten] nicht nur überflüssig, sondern können für trans Personen degradierend und invasiv sein“. Aktivist*innen hatten deshalb gehofft, dass das veraltete, archaische, und degradierende Gesetz noch in dieser Legislaturperiode reformiert wird – doch nach dem erneuten Scheitern am 19.05. scheint dies nicht mehr möglich. Trotzdem betont Rolletschke, dass es sehr wichtig sei, dass darüber gesprochen werde.
Weiterlesen Sieben Monate nach seiner Attacke, die für einen der zwei angegriffenen Männer tödlich endete, wurde er vom Dresdner Landgericht für Mord schuldig gesprochen – und zu einem Leben in Haft verurteilt. Er war davor von Ermittler*innen als islamistische Bedrohung klassifiziert worden, weswegen die Staatsanwält*innen von dem Motiv einer religiös-motivierten Homofeindlichkeit sprachen. Nachdem der Täter aus der Jugendhaft entlassen worden war, hatte er sich zwei neue Küchenmesser im Supermarkt gekauft, mit denen er sich auf die Mission machte, „Ungläubige zu töten“ – eine halbe Stunde später hatte er seine Opfer gefunden. Er stach beide Männer in den Rücken, einer von ihnen überlebte. Der Täter offenbarte, dass er aufgrund der schwulen Sexualität der Männer gehandelt habe – diese habe er als „schwere Sünde“ empfunden und wollte sie deswegen mit dem Tod bestrafen. Bevor er aus der Jugendhaft entlassen worden war, war er als Hochrisiko Täter klassifiziert worden, was bei den Familien der Opfer Fragen danach, ob die Tat hätte verhindert werden können, auslöste. Seine Verteidigungs-Anwält*innen räumten ein, dass die Gefängnis-Autoritäten ihm erlaubt hätten sich zu radikalisieren, indem sie ihm keine religiöse Beratung anboten und ihn isolierten. So wirft das schreckliche Ereignis eine allgemeinere Frage danach auf, wie mit radikal-islamischen Einstellungen Zugewanderter im besten Fall umgegangen wird. Deutlich scheint jedoch, dass ein einfaches Wegsperren keine Lösung für religiös-motivierte Homofeindlichkeit ist.
Weiterlesen Obwohl bereits mehrere Teile des 1981 in Kraft getretenen Gesetzes für verfassungswidrig erklärt wurden, und die Bundesregierung für diese Legislaturperiode seine Reform angekündigt hatte, gilt es in Deutschland noch immer. Diesen Zustand bezeichneten Sven Lehmann und Jens Brandenburg, queerpolitische Sprecher der Bundestagsfraktionen von FDP und Grünen, als „peinlich“ – und appellierten an alle demokratischen Fraktionen, dies noch vor der Bundestagswahl zu beenden. Zwar hatte es 2019 einen sehr zurückhaltenden Gesetzentwurf gegeben, dieser wurde jedoch auf Eis gelegt – und vor wenigen Wochen teilte die SPD-Fraktion mit, dass es in dieser Legislaturperiode doch keine Reform geben werde. Eine schnelle Reform sei jedoch laut Brandenburg und Lehmann notwendig, da einzelne Vorschriften des 40 Jahre alten Gesetzes bereits sechs Mal vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurden. Während dies zwar 2011 immerhin zur Abschaffung des Sterilisationszwangs für trans Menschen führte, müssen trans Menschen nach wie vor verschiedene Schikanen ertragen: Zwei teure und zeitaufwändige Zwangsgutachten, ohne die sie staatlich nicht anerkannt werden, und die Pflicht eines amtsgerichtlichen Verfahrens. Unter dieser Pathologisierung ihrer geschlechtlichen Identität durch den Staat in einer ohnehin schwierigen Lebensphase würden die Betroffenen oftmals sehr leiden, so heißt es im Brief der beiden Bundestagsabgeordneten. Dabei hat „der Staat hat die Aufgabe, die selbstbestimmte Entfaltung des Individuums zu unterstützen, statt es daran zu hindern“, heißt es weiter. Am 19. Mai standen nun die Anträge für ein Selbstbestimmungsgesetz von FDP und Grünen zur Abstimmung. Beide Anträge hatte eine Mehrheit der Sachverständigen letztes Jahr bei einer Anhörung im Innenausschuss als erhebliche Verbesserung des Status quo angesehen. So forderten Brandenburg und Lehmann die Union, SPD, FDP, Linke und Grüne auf, am 19. Mai gemeinsam das veraltete Transsexuellengesetz zu überwinden und die geschlechtliche Selbstbestimmung der Betroffenen zu stärken. Auf Twitter verteidigte SPD-Vorsitzende Saskia Esken vor der Abstimmung, dass ihre Fraktion offenbar gegen das Gesetz stimmen würde, und machte unter anderem die Union für ein Scheitern der Gestzesreform verantwortlich. "Wer montags die Regenbogenfahne schwenkt, muss mittwochs im Bundestag Taten folgen lassen", sagte Sven Lehmann daraufhin im Bundestag in Richtung der SPD.
Gender-Neutrale Pässe im Vereinigten Königreich?
20. Mai 2021Weiterlesen In Deutschland, Kanada, und den Niederlanden gibt es – nach vielerlei bürokratischer Hürden – bereits tatsächlich die Option, sich das nicht-binäre Geschlecht X eintragen zu lassen. In vielen anderen Ländern jedoch, unter anderem auch dem Vereinigten Königreich, ist dies jedoch noch nicht möglich. Und das obwohl, wie die Huffington Post berichtet, Aktivist*innen wie Christie Elane-Cane seit über 20 Jahren dafür kämpfen. Doch, nachdem Elane-Cane zuletzt 2019 vor dem Berufungsgericht dafür argumentierte, wurde der Antrag Anfang letzten Jahres abgelehnt. Dabei sollte das simple Recht, die eigene Geschlechtsidentität in einem so wichtigen legalen Dokument wie dem Pass zu bestimmen, so nicht-binäre*r Journalist*in Jamie Windust, eine Selbstverständlichkeit sein – und nichts, was über 20 Jahre erkämpft werden muss. So werden nicht-binäre, inter- und trans-geschlechtliche Menschen gezwungen, sich selbst als Mann oder Frau zu klassifizieren, was eine psychisch hochbelastende Situation darstellen könne, da diese Entscheidung die eigene Identität abspreche. Es könne nicht sein, so Windust, dass die Existenz nicht-binärer Geschlechtsidentitäten immer noch nicht anerkannt würde. Windust könne sich dies nur damit erklären, dass cis-geschlechtliche Menschen sich nicht vorstellen könnten, ständig solche grundlegenden Barrieren überwinden zu müssen. „Wir sind keine Gruppe, deren Echtheit es zu debattieren gilt. Wir sind eine Gemeinschaft, die kämpft und braucht, dass endlich gehandelt wird“. Gender-neutrale Pässe wären daher ein wichtiger symbolischer Schritt für nicht-binäre Menschen.
Weiterlesen Statistiken zu Homophobie würden Lesben tendenziell unsichtbar belassen, so die Autor*innen der Studie. Bisherige Studien zu lesbenfeindlicher Gewalt zeigten jedoch, dass diese mangelnde Repräsentanz lesbischer Frauen aber nicht darauf zurückgehe, dass dies weniger von Gewalt betroffen seien. Frauen neigen zudem laut der Forschung dazu, homophobe Beleidigungen eher hinzunehmen, da sie durch den alltäglichen Sexismus an Abwertungen gewöhnt seien. Für die Untersuchung wurden 188 Teilnehmer*innen befragt. Von diesen bezeichnen sich die meisten als weiblich (87 %) bzw. divers (14 %) und lesbisch (58 %) bzw. queer (35 %). Die meisten Befragten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und 28 % sind nach eigener Einschätzung oft als lesbisch/queer sichtbar. Die Befragten schildern, dass die Gewalt gegen sie überwiegend im öffentlichen Raum stattfindet und zumeist von Einzelpersonen ausgeht. Beschimpfungen und Beleidigungen werden als häufigste Form von Gewalt genannt. Ein Nicht-Eingreifen Unbeteiligter in solchen Situationen wird als besonders verletzend empfunden. Gewalt im persönlichen Umfeld von Betroffenen wird zwar weniger häufig benannt, wird aber oft als belastender empfunden. Viele lesbische Frauen treffen Vorsichtsmaßnahmen, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Sie weisen verschiedenen Orten in der Stadt ein Gefühl von Unsicherheit oder Sicherheit zu, es ließen sich daraus jedoch keine allgemeineren Schlüsse bezüglich bestimmter Bezirke ableiten. Berlin werde zwar insgesamt als „Zufluchtsort“ erlebt, doch das Sicherheitsgefühl der Befragten hat in den letzten Jahren abgenommen. Verschränkungen mit anderen Diskriminierungsformen spielen bei Gewalt gegen Lesben eine große Rolle. Bei lesbenfeindlicher Gewalt verschränken sich fast immer Homophobie und Sexismus. Dies macht diese Form der Gewalt im öffentlichen Bewusstsein eher unsichtbar und führt möglicherweise auch mit dazu, dass die Dunkelziffer bei lesbenfeindlicher Gewalt besonders hoch zu sein scheint. Das bestätigt sich auch in der Befragung: Von 188 Befragten berichtet über ein Drittel von lesbenfeindlicher Gewalt oder übergriffigem Verhalten im vergangenen Jahr. Doch nur jeweils 3 % wendeten sich an eine Beratungsstelle oder zeigten die Tat bei der Polizei an. Insgesamt wurden im Jahr 2018 48 Fälle durch Beratungsstellen und Polizei registriert. Viele Befragten nehmen an, dass die Polizei nichts unternehmen wird oder unternehmen kann, und wenden sich daher nicht an sie. Zu den Gründen, warum lesbenfeindliche Gewalt in der Öffentlichkeit verhältnismäßig unbemerkt bleibt, äußert sich auch Albrecht Lüter, einer der Autor*innen des Berichts, in einem Interview: „Wir haben es hier mit vorrangig privaten Bewältigungsformen zu tun, die die Öffentlichkeit nicht erreichen. Zum einen ist es so, dass es in der Schwulenszene eine professionellere und längere Auseinandersetzung mit Antigewaltarbeit gibt. Außerdem wird die Polizei als maskuline Organisation wahrgenommen, der man eher mangelnde Sensibilität für die Belange und Gefühlswelt nach einem Angriff auf lesbische und bisexuelle Frauen unterstellt, deshalb wird die Polizei als Institution gemieden“ so Lüter. Als einen weiteren Punkt nennt er die bereits thematisierte Überschneidung von Lesbenfeindlichkeit und Sexismus. Gewalterfahrungen einer lesbischen Frau betreffen diese als Frau und als Lesbe. In einer heterosexistischen Gesellschaft seien solche Übergriffe normalisiert und würden daher nicht polizeilich angezeigt. Lesbenfeindliche Gewalt wird auch innerhalb von LSBTIQ*-Communities beschrieben, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Solche Vorfälle werden ebenfalls als besonders belastend beschrieben, da sie sich in Räumen ereignen, die eigentlich als Rückzugs- und Schutzorte fungieren sollten. Insgesamt wünschen sich die Befragten stärkere gesellschaftliche Bemühungen in Bezug auf ihre spezifische Problemlage, beispielsweise Aktionen für mehr Solidarität und Zivilcourage.
Monitoring trans- und homophobe Gewalt in Berlin
12. April 2021Weiterlesen Ziel des Monitorings ist es, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Form von Gewalt gegen LSBTIQ detailliert zu dokumentieren und gesellschaftlich für das Problem zu sensibilisieren. Hierfür wurden Statistiken von Polizei und Beratungsstellen analysiert, aber auch Berliner*innen befragt. Außerdem wird vertiefend auf lesbenfeindliche Gewalt eingegangen. Insgesamt wird von einer honen Dunkelziffer von Gewalt gegen LSBTIQ ausgegangen. Das Monitoring soll daher zusätzlich zu einer Sichtbarkeit für diese spezifischen Formen von Gewalt sorgen und Betroffene stärken. Berlins Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Diskriminierung, Dr. Dirk Behrend, sagte dazu: „So wollen wir nicht nur ein öffentliches Bewusstsein schaffen, sondern auch Betroffene motivieren, Vorfälle zu melden und zur Anzeige zu bringen.“ Der Bericht erscheint im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt” (IGSV) alle zwei Jahre und wird von der Camino gGmbH erstellt. Erstmals wurden für den Bericht auch die Daten des polizeilichen Staatsschutzes zu „Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung und/oder sexuelle Identität“ für Berlin im Zeitraum von 2010 bis 2018 differenziert ausgewertet. In Berlin werden dem Bericht zufolge mehr Fälle von Hasskriminalität aufgrund der sexuellen Orientierung und/oder Identität polizeilich angezeigt, als im gesamten sonstigen Bundesgebiet. Ab 2018, so die Autor*innen des Berichts, steigt die Zahl der Anzeigen von Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung und/oder sexuelle Identität insgesamt stark an. Auch bei Gewaltdelikten im engeren Sinn fänden sich deutliche Zuwächse, die allerdings etwas geringer ausfallen. Die Tatverdächtigen unterscheiden sich in Bezug auf ihre Staatsangehörigkeit nicht von der Berliner Gesamtgesellschaft. Sie sind mit großer Mehrheit männlich und oftmals bereits polizeilich bekannt. Der Bericht ergab, dass der überwiegende Anteil aller angezeigten Übergriffe (67,3 %) im öffentlichen und halböffentlichen Raum stattfindet. Mehr als zwei Drittel der Übergriffe in Berlin richten sich gegen ein einzelnes Opfer, wobei Männer* zu größeren Teilen (42 %) von Gewaltdelikten betroffen sind als Frauen* (36 %). Beleidigungen stellten das häufigste Delikt dar. Ein Großteil der Delikte wurde an Wochenenden, im Sommer und am späten Abend verübt. Dies lässt einen Zusammenhang mit dem Ausgehverhalten und queerer Präsenz im öffentlichen Raum vermuten.
Weiterlesen Dies hat eine Mehrheit von CDU und SPD im Bundestag beschlossen. Operative Eingriffe können nur nach Zustimmung eines Familiengerichts durchgeführt werden, und müssen dem Kindeswohl dienen. Außerdem können Eltern einer geschlechtsverändernden Operation nur zustimmen, wenn der Eingriff nicht zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden kann. FDP, Linke und Grüne enthielten sich bei der Abstimmung und kritisierten, dass das Gesetz weiterhin Lücken hätte, die den Schutz intergeschlechtlicher Kinder gefährden. Außerdem fordert die Opposition ein Zentralregister, in dem geschlechtsverändernde Behandlungen erfasst werden.