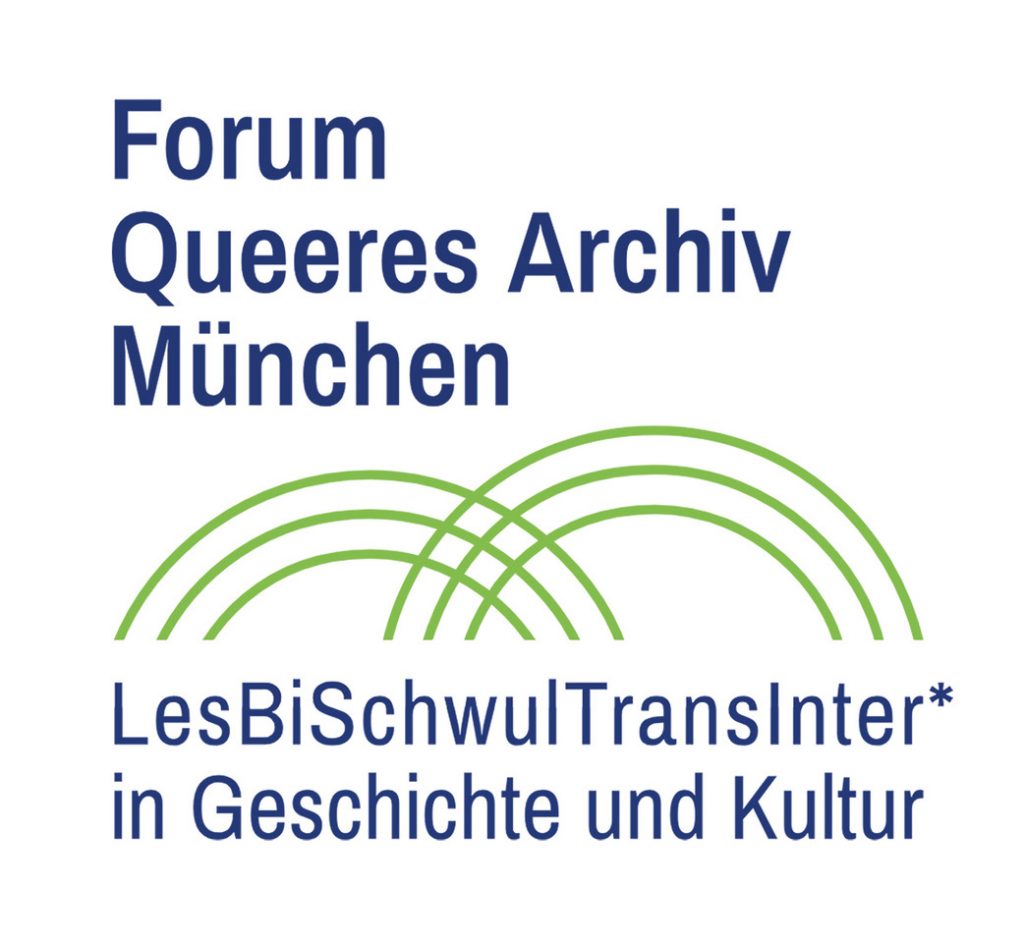Weiterlesen Im Jahr 1999 gründete sich der Verein zunächst unter dem Namen „forum homosexualität münchen – Lesben und Schwule in Geschichte und Kultur e.V.“ und sammelt und forscht seitdem zur queeren Geschichte in München und Bayern. Zum 20. Jubiläum wurde der Name modernisiert und in „Forum Queeres Archiv München e.V. – LesBiSchwulTransInter* in Geschichte und Kultur“ umbenannt. Das Archiv versucht „die Lebenskultur von LGBTIQ* der vergangenen Jahrzehnte in München und der Region zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Darin enthalten sind zahlreiche Bücher, Poster und Filme, darunter auch Aufzeichnungen von Pride-Veranstaltungen und Demonstrationen. Ebenso beinhaltet das Archiv private Tagebücher und Fotoalben von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und inter* Personen, die der Verein als besonders relevant hervorhebt: Private Dokumente hätten „zu jeder Zeit außergewöhnliche Bedeutung und sind es wert, als Zeugnisse bewahrt zu werden“. Es werden regelmäßig Führungen durch das Archiv angeboten. Im digitalen queeren Archiv sind zudem einige ausgewählte Dokumente online verfügbar – zum Beispiel eine Zeitschrift für lesbische und trans Frauen in der Weimarer Republik Die Freundin. Zu den aktuellen Projekten des Archivs gehören unter anderem die Erforschung der lesbischen Kneipengeschichte in München, eine Forschungsgruppe zum Maler Paul Hoecker sowie die Vorstellung von bayerischen LGBTIQ* Persönlichkeiten in Steckbriefen. Besonders zu empfehlen ist auch die Münchner LGBTIQ*-Chronik, die „Landmarken der LGBTIQ*-Geschichte und -Emanzipation“ in München und darüber hinaus enthält. Diese reichen vom ersten Beleg für die Verfolgung Homosexueller im 14. Jahrhundert zur Gründung schwuler Clubs in den 1920ern, der Verfolgung von LGBTIQ*-Personen im Nationalsozialismus. Sie beinhaltet auch Daten emanzipatorischer Momente der Lesben- und Schwulenbewegung in der Nachkriegszeit sowie zeitgenössische Meilensteine der queeren Szene in der bayerischen Hauptstadt. Die Ergebnisse der Arbeit des Queeren Archiv München werden auch in diversen Publikationen bereitgestellt. Zudem veranstaltet der Verein regelmäßig Events zum Thema. Logo: Forum Queeres Archiv München
Dokumentation
Queeres Erinnern am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2026
22. Januar 2026Weiterlesen Warum das Gedenken wichtig ist? Queere Personen waren eine Gruppe verfolgter Menschen durch den Nationalsozialismus. Leben in sexueller und geschlechtlicher Vielfalt hatte Unterdrückung, Gefahr für das Leben und Gewalt zur Folge. Viele der Veranstaltungen wollen gedenken und erinnern, aber auch Zusammenhänge herstellen zu der Lebensrealität queerer Personen im heutigen Deutschland. Überörtlich Gedenkstunde im Deutschen Bundestag Datum & Uhrzeit: 28. Januar 2026 um 12.30 Uhr Ort: Deutscher Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlin) Veranstaltende: Deutscher Bundestag Weitere Infos: Pressemitteilungen Deutscher Bundestag, Möglichkeiten zum Fernseh- oder Hörfunk ZDFinfo Dokutag am 27. Januar 2026 Am Holocaust-Gedenktags 2026 zeigt ZDFinfo am Dienstag, 27. Januar 2026, ab 7.00 Uhr Filme über die Geschichte des Nationalsozialismus und das Gedenken an die Opfer Weitere Infos: ZDF-Presseportal Umfangreiches Programmangebot des ZDF anlässlich des Holocaustgedenktages 2026 abrufbar in der ZDF-Mediathek z.B. Doku „Verbotene Liebe – Queere Opfer in der NS-Diktatur“ von Sebastian Scherrer Lübeck Gedenken und Kranzniederlegung für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus in Lübeck Datum & Uhrzeit: 23. Januar 2026 um 18.00 Uhr Ort: Denkmal für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle (Parade 12, 23552 Lübeck) Veranstaltende: Lübecker CSD e.V. Weitere Infos: Lübeck Pride e.V., Erinnern Lübeck Bremen Ausstellung: gefährdet leben. Queere Menschen 1933–1945 Datum & Uhrzeit: Eröffnung: 25. Januar 2026 um 11.00 Uhr, Ausstellung: 26.01.-15.03.2026 Ort: Zentrum für Kunst (Hermann-Ritter-Straße 108, 28197 Bremen) Veranstaltende: Rat & Tat-Zentrum für queeres Leben e.V., Erinnern für die Zukunft e.V. & Landeszentrale für politische Bildung Bremen Weitere Infos: Ausstellung gefährdet leben, Gesamtprogramm Gedenken in Bremen Januar-April 2026 Gedenken des Senats an die Opfer des Nationalsozialismus 2026 (mit der Schwerpunktperspektive auf queere Opfer) Datum & Uhrzeit: 27. Januar 2026 um 19.00 Uhr Ort: Obere Halle, Bremer Rathaus (Am Markt 21, 28195 Bremen) Veranstaltende: breites Bündnis aus Vereinen, Initiativen und Kooperationspartnern, Koordination: Erinnern für die Zukunft e.V. & Landeszentrale für politische Bildung Weitere Infos: Landeszentrale für politische Bildung Bremen, Gesamtprogramm Gedenken in Bremen Januar-April 2026 Bremen before Stonewall – Queerhistorische Geschichte(n) Datum & Uhrzeit: 1. Februar 2026 um 15.00 Uhr Ort: Krankenhaus-Museum (Züricher Straße 40, 28325 Bremen) Veranstaltende: mit Elisabeth Schindler auf Spurensuche Weitere Infos: Kultur Ambulanz Bremen, Gesamtprogramm Gedenken in Bremen Januar-April 2026 Hamburg Rundgang anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus Datum & Uhrzeit: 27. Januar 2026 um 13.00 Uhr Ort: denk.mal Hannoverscher Bahnhof (Lohseplatz, 20457 Hamburg) Veranstaltende: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen Weitere Infos: Gedenkstätten Hamburg Berlin Gedenken des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas Datum & Uhrzeit: 28. Januar 2026 um 14.00 Uhr Ort: Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas (Simsonweg, 10557 Berlin) Veranstaltende: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Weitere Infos: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Gedenken mit Kranzniederlegung an die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten LSBTIQ* Datum & Uhrzeit: 28. Januar 2026 um 15.00 Uhr Ort: am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen (Ebertstraße auf Höhe Hannah-Arendt-Straße, 10785 Berlin-Tiergarten) Veranstaltende: LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg e. V., LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt e.V. & Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Weitere Infos: LSVD+ Köln Gedenken an die queeren Opfer der NS-Zeit 2026 Datum & Uhrzeit: 27. Januar 2026 um 17.00 Uhr Ort: am Mahnmal „totgeschlagen – totgeschwiegen“ (Trankgasse 20, 50667 Köln) Veranstaltenden: Queeres Netzwerk NRW, LSVD+ Landesverband NRW, Netzwerk geschlechtliche Vielfalt Trans NRW, Arcus Stiftung Weitere Infos: Queeres Netzwerk NRW Düsseldorf Stolperstein-Spaziergang Datum & Uhrzeit: 26. Januar 2026 um 17.30 Uhr Ort: Denkmal auf der Apollowiese (Mannesmannufer 1, 40213 Düsseldorf) Veranstaltende: Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V. Weitere Infos: Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V. Dokumentarfilm „Klänge des Verschweigens. Ein detektivischer Musikfilm“ von Klaus Stanjek über seinen schwulen Onkel in der NS-Zeit Datum & Uhrzeit: 27. Januar 2026 um 19.00 Uhr Ort: Bambi Filmstudio (Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf) Veranstaltende: Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V. Weitere Infos: Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V.
Weiterlesen Provokante Botschaften, um Missstände sichtbar zu machen Die Kampagne nutzt queerfeindliche Stereotype als Spiegel der Realität, die viele LSBTIQ*-Menschen im Arbeitsleben weiterhin erleben müssen. In einem auffälligen Retro-Pop-Art-Look heißen die Visuals etwa: Doch der provokante Stil verfolgt einen klaren Zweck: Vorurteile und strukturelle Barrieren sichtbar machen, die queere Menschen im Berufsalltag häufig ausbremsen. Der Clou der Kampagne: Wer sich noch an diese Denkmuster klammert, ist ausdrücklich nicht die Zielgruppe, denn Queermentor will Unterstützer*innen, die bereit sind, Vielfalt zu fördern. Der Twist: Haltung statt Anbiederung Anstatt um Akzeptanz zu bitten, setzt Queermentor auf Werte und klare Positionierung. Die Botschaft lautet: Wer im „Vorgestern“ verharrt und Veränderung ablehnt, soll nicht spenden. Warum diese Kampagne notwendig ist Gründer Pavlo Stroblja erklärt, warum die Kampagne bewusst provoziert: „Als queere Person habe ich selbst erfahren, wie subtil und offen Vorbehalte im Berufsleben wirken können. Deshalb setzen wir bewusst auf Provokation, um vorherrschende Biases und Barrieren sichtbar zu machen.“ Queermentor nutzt die Kampagne damit als Aufklärung und als Aufruf, sich gegen Diskriminierung zu positionieren und nicht wegzuschauen. Wofür Queermentor steht: Empowerment, Chancen, Sicherheit Queermentor ist mehr als ein Mentoring-Programm. Die Organisation setzt sich aktiv für eine Arbeitswelt ein, in der queere Menschen gleiche Chancen erhalten, unabhängig von Herkunft, Einkommen oder sozialer Lage. Die Initiative bietet: Damit erfüllt Queermentor eine zentrale Mission: Queere Menschen stärken – persönlich, beruflich und gesellschaftlich. Spenden für eine sichere Zukunft der Programme Damit das kostenfreie Angebot auch 2026 fortgeführt werden kann, ist Queermentor auf Spenden angewiesen. Unterstützer*innen können jederzeit über die Website spenden.
Wer eine gerechte, vielfältige Arbeitswelt will, ist eingeladen zu unterstützen.
Damit wählt die Organisation bewusst einen Weg, der queere Selbstbestimmung und Stärke in den Mittelpunkt stellt – in einer Zeit, in der queeren Themen gesellschaftlich wie politisch verstärkt Gegenwind entgegenweht.
Aufruf für die Portraitserie: „Queere Lebensgeschichten über 60“
9. Dezember 2025Weiterlesen Schon seit 2022 erzählt das Fotoprojekt die Geschichten queerer Menschen in Deutschland, insbesondere von Menschen mit einem Mindestalter von 60 Jahren, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans, inter, nicht-binär oder queer identifizieren. Das Projekt und Markus Heft wurden bereits mehrmals mit Preisen ausgezeichnet. Nun soll das Projekt erweitert und in einem Fotoband unter dem Titel „Für uns geträumt“ im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Dafür werden weiterhin Menschen gesucht, die sich portraitieren lassen möchten und ihre queere Lebensgeschichte erzählen möchten. Markus Heft, 1998 geboren, setzt dieses Projekt um, weil er auf der Suche nach queeren Vorbildern ist, die ihm im Jugendalter gefehlt haben. Auch wenn vor allem eine aktuell ältere Generation porträtiert wird, soll das Projekt einen Austausch zwischen den Generationen anstoßen. Im Fokus stehen spannende Erlebnisse, Herausforderungen und Kämpfe, die vor Hefts eigener Generation stattfanden und eine queere Lebensgeschichte geprägt haben. Außerdem dreht es sich um die Bedeutung von Sexualität und Identität im Alter. Markus Heft: „Die Fotos entstehen in einem kollaborativen Prozess. Einzel- oder Paarportraits werden durch Detailaufnahmen von Gegenständen oder Orten, die von Bedeutung sind, ergänzt. Zusätzlich werde ich mit allen Teilnehmenden Interviews führen, um einen individuellen Fokus auf das Leben meiner Protagonist*innen zu legen.“ Momentan ist Markus Heft explizit auf der Suche nach trans, inter und nicht-binären Personen, sowie nach Menschen, die in der DDR lebten. In Alltagsgeschichten möchte er über Themen wie Beziehung, Familie, Einsamkeit, Stolz, erkämpfte Rechte, Berufe sowie Wohnen und Pflege im Alter sprechen. Dabei bleibt er offen für Themen, die die Portraitierten mitbringen. Markus Heft: „Das Fotoprojekt ist eine Einladung zur Zusammenarbeit: Es geht mir nicht darum, ein Projekt über Menschen zu machen, sondern gemeinsam mit ihnen ihre Geschichten zu erzählen.“ Eine Veröffentlichung für den Fotoband und Ausstellungen erfolgt nur nach vorheriger Absprache und Einverständnis. Wenn Du Interesse hast, Teil des Fotoprojekts zu werden oder Fragen dazu hast, melde dich per E-Mail unter info@markusheft.de. Weitere Infos und Quelle: Markus Heft
Demos gegen Merz-Aussage: Für Vielfalt und gegen Ausgrenzung
28. Oktober 2025Weiterlesen Trotz der Proteste erhielt Merz Rückendeckung, etwa vom offen schwulen CDU-Politiker Jens Spahn, der die Äußerungen verteidigte. Kritik: „Wenn Herr Merz über das Stadtbild spricht, dann meint er auch mich“ Auf der Berliner Kundgebung machte eine trans Frau deutlich, dass Merz’ Aussagen nicht nur Migrant*innen, sondern auch queere Menschen treffen würden: Damit sprach sie vielen aus der Seele: Die Sorge wächst, dass queere Menschen – nach Migrant*innen und anderen Minderheiten – zum nächsten Feindbild politischer Stimmungsmache werden könnten. Die Teilnehmenden forderten eine klare Abkehr von rechtspopulistischer Sprache und ein Bekenntnis zu einer offenen, solidarischen Gesellschaft, in der Vielfalt sichtbar und geschützt ist. „Stadtbild“ oder „Weltbild“? Die Redner*innen warfen Merz vor, mit seinen Worten ein verengtes, normatives Weltbild zu transportieren. Wer nicht ins konservative Schema passe – ob queer, arm oder migrantisch – werde als „Problem“ wahrgenommen. Ein Demonstrationsbanner brachte es auf den Punkt: „Lieber Menschenrechte als rechte Menschen.“ Erinnerung an frühere queerfeindliche Äußerungen Die Kritik an Merz knüpfte an frühere Aussagen an: Bereits im Juni hatte er in einer Talkshow mit Blick auf queere Menschen von einem „Zirkuszelt“ gesprochen. Viele Demonstrierende sahen darin eine wiederkehrende Abwertung queerer Lebensrealitäten und forderten eine klare Distanzierung der CDU von solchen Haltungen. Queere Sicht: Solidarität statt Spaltung Queere Aktivist*innen warnten, dass rechte und konservative Diskurse gezielt versuchten, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen – etwa Migrant*innen gegen Queers.
Für viele in der queeren Community war das ein weiterer Beleg dafür, dass auch innerhalb der Union queerfeindliche und rassistische Narrative zunehmend normalisiert werden.
„Wenn Herr Merz über das Stadtbild spricht, dann meint er nicht nur Menschen, die nicht weiß sind – dann meint er auch mich.“
Die Demonstrationen betonten dagegen Solidarität: Ein vielfältiges Stadtbild bedeute, dass alle dazugehören – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Identität.
Weiterlesen Wie queer.de berichtet, sind laut Regierung lose rechtsextreme Gruppierungen, die sich über soziale Medien und Messenger organisieren, ein wesentlicher Treiber. Diese Gruppen – etwa „Jung & Stark“ oder „Deutsche Jugend Voran“ – mobilisieren schnell und treten unter anderem mit Störaktionen gegen CSDs (Christopher Street Days) auf. Die Bundesregierung nennt gezielte Hetze gegen die LSBTIQ*-Community als einen aktuellen Schwerpunkt der Szene. Über soziale Netzwerke rekrutieren rechtsextreme Akteure junge Menschen, oft unterstützt durch „extremistische Influencer“. Auch Jugendorganisationen rechtsextremer Parteien wie „Die Heimat“ (ehemals NPD) oder „Der III. Weg“ wirken im Internet erfolgreich. Selbst die mittlerweile aufgelöste Junge Alternative der AfD wird als Beispiel genannt. Grünen-Politikerinnen Schahina Gambir und Marlene Schönberger kritisieren, dass die Bundesregierung trotz der wachsenden Gefahr keinen klaren Handlungsplan habe und sogar bei Präventions- und Aussteigerprogrammen sparen wolle. So soll etwa der Etat der Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt werden – obwohl der Haushalt des Innenministeriums insgesamt steigt. Grünen-Politikerin Marlene Schönberger warnte, rechtsextreme Jugendliche und junge Erwachsene stellten „eine massive Gefahr für unsere Demokratie“ (queer.de) dar. Tatsächlich sieht der Haushaltsentwurf Einsparungen im Bereich der politischen Bildung vor: Der Etat der Bundeszentrale für politische Bildung soll bis 2026 laut Spiegel um mehr als zwei Millionen Euro sinken. Gleichzeitig wächst jedoch der Gesamthaushalt des Bundesinnenministeriums – um rund 841 Millionen Euro.
Daten am Rand: LSBTIQ* in europäischen Forschungsarchiven
25. September 2025Weiterlesen Vor diesem Hintergrund widmete sich das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln dem Thema „Data on the Margins“. Die Autor*innen Anya Perry und Jonas Recker gingen der Frage nach, wie sichtbar queere Lebensrealitäten in sozialwissenschaftlichen Datenarchiven Europas sind. Ziel ihrer Untersuchung war es, die Datenlage zu LSBTIQ*-Personen systematisch zu erfassen und bestehende Lücken sichtbar zu machen. Das Forschungsteam analysierte 34 sozialwissenschaftliche Datenarchive, die Teil des europäischen Forschungsdatenverbunds CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) sind. Diese Archive bilden eine zentrale Infrastruktur für sozialwissenschaftliche Forschung in Europa und prägen maßgeblich den wissenschaftlichen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Insgesamt fanden die Autor*innen 66 relevante Datensätze, davon enthielten Darüber hinaus wurde untersucht, ob diese Merkmale als Hauptthema oder lediglich als Randnotiz auftauchen und ob sie mit anderen Merkmalen wie Alter, Behinderung oder Migration intersektional verknüpft sind. Auch geografische Abdeckung und zeitliche Lücken wurden systematisch erfasst. Die Analyse zeigt: Die Datenlage zu LSBTIQ*-Personen in europäischen sozialwissenschaftlichen Archiven ist fragmentiert, lückenhaft und häufig defizitorientiert. Die Erfassung erfolgt oft unsystematisch, etwa als Nebenmerkmal oder über offene Antwortoptionen. Geschlechtsidentität und Intersex-Merkmale sind deutlich unterrepräsentiert. Die thematische Ausrichtung der Datensätze ist einseitig: Gesundheitsthemen – insbesondere im Zusammenhang mit HIV/AIDS – dominieren. Themen wie psychische Gesundheit, ökonomische Lebenslagen, Reproduktion und soziale Wohlfahrt sind hingegen stark unterbelichtet. Geografische Lücken bestehen vor allem in Island, der Ukraine und Teilen Osteuropas, während historische Daten insbesondere für die Zeit zwischen den 1950er und 1970er Jahren fehlen, was eine kontinuierliche Forschung erschwert. Die Autor*innen enden mit einem klaren Appell, die sozialwissenschaftliche Forschung von einer defizitorientierten Perspektive zu lösen und stattdessen empowernde, inklusive und intersektionale Ansätze in den Mittelpunkt zu stellen. Daten über LSBTIQ*-Personen sollten nicht nur zur Dokumentation von Problemen dienen, sondern auch dazu, Ressourcen, Widerstandskraft und Vielfalt sichtbar zu machen. Zudem betonen sie die Notwendigkeit eines Dialogs mit den betroffenen Communities – nicht nur bei der Erhebung, sondern auch bei der Verwendung und Interpretation der Daten. Die Studie ist damit mehr als eine Bestandsaufnahme – sie ist ein Weckruf für die sozialwissenschaftliche Forschung, endlich auch jene Lebensrealitäten systematisch zu erfassen, die bislang am Rand standen Für Interessierte gibt es zudem eine vollständige Präsentation (auf Englisch) der Autor*innen auf dem YouTube-Kanal von GESIS.
Queerness in der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung: Entwicklungen und Problemlagen
28. August 2025Weiterlesen Dass queere Schwangere im Kontext von Geburtshilfe oft diskriminierende Erfahrungen machen, wurde in einer Studie von Ska Skalden und dem Netzwerk Queere Schwangerschaften aus dem Jahr 2022 offengelegt. Dies war die erste quantitative Studie in Deutschland zum Thema. Die Hälfte der trans* und intergeschlechtlichen Befragten gab darin an, bei der Geburt ihrer Kinder in Kliniken Gewalt oder Diskriminierung erfahren zu haben (im Vergleich: Auch 20 Prozent der cis-geschlechtlichen Befragten berichten von solchen Erfahrungen). Ökonomisch bedingter Zeitdruck und Personalmangel prägen oft die Betreuung in Krankenhäusern. Allgemeine Reformen in der klinischen Geburtshilfe würden daher auch queeren Gebärenden zugutekommen, wie in dem auf der Studie aufbauenden Policy Paper betont wird. Darüber hinaus berichtet die Hebamme Lucie Lowitz über strukturelle Probleme für queere Schwangere: „Die Bürokratie ist heteronormativ orientiert, zum Beispiel wird die gebärende Person immer als Mutter eingetragen. Da keine männlichen Personen als Mutter eingetragen werden, kommt es häufig zur Verwendung von Deadnames.“ Lowitz erklärt, dass aus Angst vor Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen manche Menschen nicht im Krankenhaus gebären wollen, sondern Hausgeburten oder Geburten mit Beleghebammen bevorzugen. Bei queeren Paaren gibt es zudem weitere rechtliche Hürden: Bei lesbischen Paaren zum Beispiel wird die nicht gebärende Mutter, anders als bei verheirateten heterosexuellen Paaren, nicht automatisch als Elternteil eingetragen, sondern muss das Kind adoptieren. Queere Initiativen fordern seit langem eine Anpassung des Abstammungs- und Familienrechts. Eine entsprechende Reform wurde von der Ampelregierung zwar im Koalitionsvertrag festgelegt, jedoch nicht innerhalb ihrer Legislaturperiode durchgesetzt. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung ist keine derartige Reform für Regenbogenfamilien geplant (für eine Übersicht der Forderungen und Entwicklungen siehe die Webseite des LSVD+). Im Policy Paper werden verpflichtende Fort- und Weiterbildungsangebote für Personal in der Geburtshilfe zu sexueller und geschlechtlicher Diversität gefordert. Zudem sollen Forschungsvorhaben zu geburtshilflichen Themen, die für queere Menschen relevant sind, gefördert werden. Im Gespräch hebt Lowitz positiv hervor, dass es erste queerfeministische Hebammenpraxen sowie zunehmend queere Geburtsvorbereitungskurse gebe. Das Fortbildungskollektiv Queer*Sensible Geburtshilfe aus Hebammen und Mediziner*innen beispielweise klärt über solche Themen auf und bietet Fortbildungen für verschiedene Fachgruppen in der Geburtshilfe an. Eine Empfehlung zum Thema: In der WRD Doku „Der Schwangere Mann“ begleitet die Filmemacherin Jeanie Finlay den trans* Mann Freddy über den Prozess seiner Schwangerschaft.
Zum Jahresbericht 2024: Die Antidiskriminierungsstelle Schleswig-Holstein zieht Bilanz
7. August 2025Weiterlesen Der Tätigkeitsbericht hebt laut Pressemitteilung insbesondere die „vielen Anfragen zum Umgang mit sexuellen Belästigungen durch Arbeitskollegen im Privatleben und die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis“ hervor. Ein weiteres wiederkehrendes Thema ist Mobbing, das ebenfalls in den Fokus der Arbeit rückt. Positiv bewertet wird, dass Arbeitgeber*innen sich im Rahmen von Schulungen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zunehmend für diese Problematik sensibilisieren. Auch außerhalb des Arbeitsplatzes werden die Schulungen und Beratungsangebote weiterhin stark nachgefragt und als wirksame Instrumente wahrgenommen. Gleichzeitig weist der Bericht darauf hin, dass trotz der seit 2006 gesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen Beschwerdestellen weiterhin zahlreiche Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle eingehen. Zudem zeigt sich, dass das AGG in bestimmten Bereichen – etwa im schulischen Kontext, bei Behörden oder in Vereinskonflikten – häufig nicht anwendbar ist. Vor diesem Hintergrund berät der Landtag derzeit über ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG). Eine finale Entscheidung steht noch aus. Das LADG soll sich dabei am Berliner Vorbild orientieren – bislang das einzige Landesgesetz, das Bürger*innen bei Benachteiligung durch Behörden aufgrund bestimmter Merkmale einen Schadensersatzanspruch zuspricht. Dabei läge es eigentlich im eigenen Interesse von Unternehmen, aber auch von Behörden, sich gegen Diskriminierung aufzustellen: Eine diskriminierungssensible Unternehmens- und Behördenkultur steigert laut der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Samiah El Samadoni nicht nur die Mitarbeiter*innenbindung und Fachkräftegewinnung, sondern auch das Ansehen bei Kund*innen und Geschäftspartner*innen. Gleichzeitig warnt El Samadoni eindringlich vor einem gesellschaftlichen Klima, das durch sprachliche Verrohung und menschenverachtende Äußerungen zunehmend belastet wird – wie etwa rassistische Inhalte in Stellenanzeigen oder diskriminierende Gesänge, jüngst beobachtet auf Sylt. Um solchen Entwicklungen zu begegnen, fordert sie mehr Sensibilisierung, Gesetzeserweiterungen und aktives Engagement für eine respektvolle und vielfältige Gesellschaft, um verletzendes Verhalten nicht zu normalisieren. Dabei ist es wichtig, die Adressat*innen der Forderungen klar zu trennen. Hier geht es zur Pressemitteilung zum Bericht. Hier gibt es den Jahresbericht 2024 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Weiterlesen Doch jenseits von Glamour und Bühnenshows entzündete sich eine hitzige Debatte: Insbesondere das Zuschauervoting für Israel führte laut Wikipedia zu Vorwürfen der Manipulation und Fragen zur Transparenz der Abstimmungsregeln. Bereits im Vorfeld war die Teilnahme Israels aufgrund des Gaza-Kriegs umstritten gewesen. Der ESC ist längst mehr als eine bunte Show – er entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Zeichen europäischer Verständigung und wurde während des Kalten Krieges zur Bühne liberaler Werte. Die SRF-Sendung „Sternstunde Philosophie“ vom 12. Mai griff dies auf: Moderator Yves Bossart sprach mit Kulturjournalist Jens Balzer über den ESC als Ort politischer Botschaften und als „safe space“ für Queerness und Vielfalt. Balzer betonte, dass sich der ESC seit den 1970ern für Diversität stark mache und queere Popkultur in den Mainstream getragen habe. Gleichzeitig kritisierte er, dass sich Teile der sogenannten „woken Kultur“ in ein konsumorientiertes Spektakel verwandelt hätten, das teils erneut zur Ausbeutung und auch Ausgrenzung führe. Der Begriff „woke“ stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und beschreibt ursprünglich ein wachsames Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit. Heute wird er oft politisch instrumentalisiert – etwa von Rechtspopulisten wie Donald Trump oder von Regierungen in Russland und Ungarn, die den ESC als Symbol für Dekadenz und Familienfeindlichkeit deuten. Doch auch westliche EU-Staaten müssen sich Kritik gefallen lassen: Laut Balzer weigerten sie sich jahrelang, osteuropäische Länder in den Wettbewerb zu integrieren – aus Angst vor sinkenden Quoten. Der ESC bleibt also eine Projektionsfläche: für Musikträume, gesellschaftliche Auseinandersetzung und den Wandel Europas. Das Gespräch mit Jens Balzer lädt dazu ein, den Contest, aber auch die Popkultur ganz allgemein neu zu betrachten, selbst wenn man nicht alle Aussagen teilt. Programmtipp: Die vollständige Sendung „Der ESC – über Politik, Queerness und die Zukunft Europas“ aus der Reihe Sternstunde Philosophie ist auf dem YouTube-Kanal von SRF Kultur oder als Audiopodcast auf SRF.ch verfügbar.