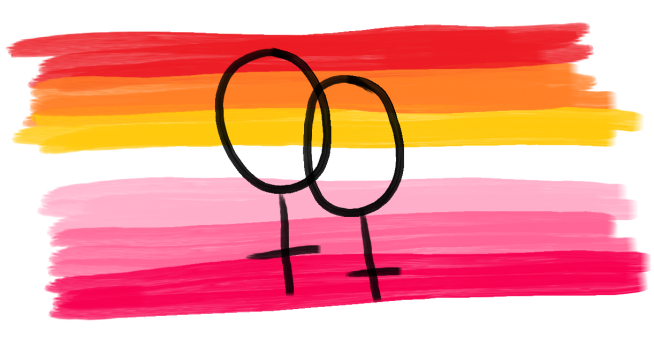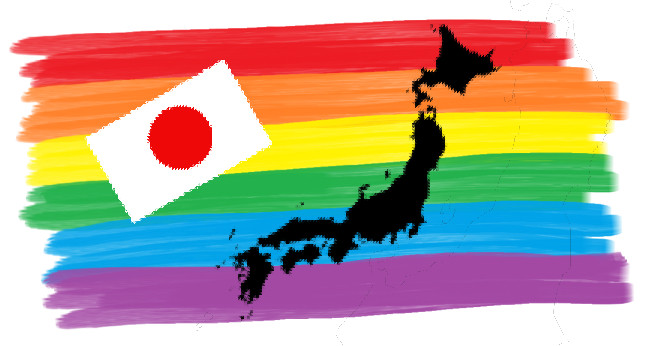Weiterlesen Die Stiftung setzt sich weltweit für Menschenrechte von LSBTIQ ein und unterstützt Partnerorganisationen im globalen Süden und in Osteuropa. Durch Aufklärung- und Überzeugungsarbeit bei politisch Verantwortlichen sowie Kampagnen gegen Homophobie und strafrechtliche Verfolgung soll die Menschenrechtssituation von LSBTIQ verbessert werden. „In 76 Staaten wird Homosexualität heute noch strafrechtlich verfolgt, in einigen Ländern der islamischen Welt sogar mit Todesstrafe bedroht. Vielerorts sind staatliche Behörden an der Unterdrückung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender beteiligt, verweigern ihnen jeglichen Schutz vor Anfeindungen und Gewalt“ so schreibt die Stiftung über ihr Problemfeld. Auch in Europa schlage Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender mitunter noch Hass entgegen und werden ihre Grundrechte eingeschränkt. Grundlage der Arbeit sind die Yogykarta-Prinzipien, eine Zusammenstellung von Menschenrechtsstandards in Bezug auf sexuelle Minderheiten und LSBTIQ, die von führenden Menschenrechtsexpert*innen entwickelt wurde. Zu den Strategien der Stiftung zählt die direkte Hilfe für LSBTIQ-Organisationen und Projekten im Ausland, die Organisation von Menschenrechtskongressen und Tagungen, internationale Lobbyarbeit, Informationsvermittlung und Forschung. Die Arbeitsschwerpunkte liegen bisher in Afrika, Mittelamerika und Osteuropa. Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung gibt außerdem eine Schriftenreihe heraus. Zu den erschienenen Bänden gehört unter anderem eine deutschsprachige Übersetzung der Yogykarta-Prinzipien.
LSBTIQ
Studie: LSBTI überdurchschnittlich stark durch Einsamkeit während der Corona-Krise belastet
29. März 2021Weiterlesen Die Forscher*innen um Wolfram Hermann führten die Befragung mittels eines Online-Fragebogens durch. Im März/April 2020 gab es eine erste Erhebungswelle, im Januar/Februar 2021 fand zweite Befragung statt. Ziel der Studie des Instituts für Allgemeinmedizin war es, die Situation und das Befinden von Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie zu untersuchen. Dabei lag ein Schwerpunkt der Studie auf LSBTI-Menschen. „Es zeigt sich, dass Teilnehmer*innen, ohne Partner, ohne Kind, alleine wohnend, unter 65 und LGBTIA+ einsamer waren“ schreiben die Autor*innen der Studie über die bisherigen Ergebnisse. Auch zeigte sich eine höhere Einsamkeit in der zweiten Befragungswelle im Vergleich zur ersten Befragungswelle. In der Gruppe der LGBTIA+ Menschen seien vor allem asexuelle Menschen, trans Menschen und non-binäre Menschen besonders ausgeprägt von Einsamkeit betroffen, auch wenn diese in einer Partnerschaft seien. Die Pandemie belaste insbesondere Menschen, die vorher schon von psychischen Problemen betroffen waren. So gaben Befragte, die sich während der Befragung in Psychotherapie befanden, an, dass die Psychotherapie während der Pandemie seltener stattfand oder langfristig ausfiel. Insgesamt, so die Forscher*innen, zeige sich weiterhin ein hoher psychosozialer Unterstützungsbedarf. Insbesondere asexuellen, trans und non-binäre Menschen sollten digitale Unterstützungs- und Vernetzungsangebote als Mittel gegen Einsamkeit angeboten werden. Hausärzt*innen sollten bei Patient*innen, die sich zurzeit in Psychotherapie befinden, gezielt nachfragen, ob diese aktuell ausreichend stattfindet. Es sei außerdem empfehlenswert, wenn Hausärzt*innen bei LGBTIA+ Patient*innen gezielt nach Einsamkeit fragen.
lesbisches Wohnprojekt benötigt Geld
27. März 2021Weiterlesen Wie das Berliner Queer-Magazin Siegessäule nun berichtet, fehlen dem Projekt rund eine Million Euro. Die Mittel werden unter anderem für die Projektsteuerung, fachliche Beratung und für die Ausstattung sowie langfristige Sicherung des Wohnprojekts benötigt. Derzeit versucht die Projektgruppe, das Geld über Anträge und Spenden zu akquirieren. Jutta Brambach, Projektleiterin, sieht aber auch die Politik in der Pflicht: „Es braucht einfach mehr – wenn man ein Leuchtturmprojekt lesbischer Sichtbarkeit wirklich umsetzen möchte. Die Politik muss auch Geld in die Hand nehmen. Das geht dann nicht anders.“ Unter rut-wohnen.de finden Sie weitere Informationen, wie das Projekt mit einer Spende unterstützt werden kann.
Weiterlesen Japan hat als bisher einziger G7-Staat die „Ehe für alle“ bisher nicht anerkannt. Nun entschied in der nordjapanischen Stadt Sapporo ein Bezirksgericht, dass Weigerung Japans, gleichgeschlechtliche Ehen offiziell anzuerkennen, das verfassungsmäßige Recht auf Gleichbehandlung verletzt. 2019 hatten mehrere Paare von verschiedenen Gerichten des Landes gegen ihre Diskriminierung geklagt und verlangten außerdem eine Entschädigung für das Unrecht. Vor dem Gericht in Sapporo hatten drei Paare geklagt. Das Urteil von Sapporo könnte nun wegweisend für weitere Gerichtsverfahren sein. Aktivist*innen begrüßten das Urteil. Die Anwälte der Kläger*innen betonten, es handle sich um "einen großen Schritt hin zur Gleichberechtigung bei der Ehe". Ob der Gesetzgeber nun jedoch die notwendigen Reformen einleitet, um die gleichgeschlechtliche Ehe endlich zu ermöglichen, ist weiterhin unklar. Für eine Gesetzesänderung ist eine Mehrheit im Parlament von Nöten. Laut Umfragen befürwortet inzwischen jedoch eine Mehrheit der Japaner*innen die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Einige Gemeinden haben bereits in den letzten Jahren Partnerschaften von homosexuellen Menschen eigenständig anerkannt. Hier können sich Paare ein Zertifikat als „gleichgeschlechtliche Lebenspartner“ ausstellen lassen. Eine solche Eintragung einer Partnerschaft ist zwar rechtlich nicht bindend, ist aber ein Schritt gegen alltägliche Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die gleichen Rechte wie heterosexuelle Ehepaare haben Menschen, die eine solche Lebenspartnerschaft eintragen lassen, jedoch auch weiterhin nicht.
Weiterlesen Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) äußerte sich in einem TAZ-Interview über die Hintergründe des Beschlusses: „Weltweit, aber auch in Europa, gehören LGBTI nach wie vor mit zu den verwundbarsten Gruppen, die Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt sind. In mehr als 70 Staaten weltweit werden LGBTI vom Staat verfolgt und bestraft. In einigen Staaten steht auf Homosexualität sogar noch die Todesstrafe.“ Es solle Grundsatz der Politik der Bundesregierung in der internationalen Politik werden, dass LGBTI-Rechte Menschenrechte seien. Vorreiter*innen mit ähnlichen Strategien seien unter anderem die skandinavischen Länder. Die queerpolitischen Sprecher*innen der grünen Bundestagsfraktion begrüßten das Konzept kritisierten jedoch, dass dieses „längt überfällig“ gewesen sei. Nun müsse der Beschluss schnellstmöglich in die Arbeit des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums Einzug erhalten: „Deutschland als eines der größten Geberländer darf angesichts der verheerenden Situation für LSBTI in manchen Regionen der Welt keine weitere Zeit zu verlieren.“ Der Beschluss der Bundesregierung müsse auch Selbstverpflichtung sein, viel stärker als bisher auf die Einhaltung von Menschenrechten zu drängen. Außerdem dürfe die Bundesregierung nicht mehr Staaten zu „sicheren Herkunftsländern“ erklären und Abschiebungen in diese durchführen, in denen Homosexualität strafrechtlich verfolgt werde.
Echte Vielfalt in der katholischen Kirche?
24. März 2021Weiterlesen Denn wie Maria 2.0 einräumt, sei die offizielle Sexualmoral der katholischen Kirche, wie sie aktuell gelehrt werde „lebensfremd und diskriminierend“: So dürfen beispielsweise gleichgeschlechtliche Paare in der katholischen Kirche noch immer nicht heiraten (und in der evangelischen Kirche können sie nur „gesegnet“ werden), auch das Pflichtzölibat besteht noch. Zudem ist die katholische Kirche eine der einzigen Institutionen in der Welt, die Frauen explizit von bestimmten Ämtern ausschließt – obwohl Menschenrechte und Grundgesetz allen Menschen gleiche Rechte garantieren. Deswegen forderte das Katholische LSBT+ Komitee gemeinsam mit anderen Reformbewegungen der katholischen Kirche (unter anderem Maria 2.0) in einem öffentlichen Appell an die Bischofskonferenz, dass es ein Umdenken bei der Sexualmoral und Akzeptanz sexueller Minderheiten brauche: „Die Kirche braucht einen neuen und positiven Zugang zur Sexualität, ihrer bewussten Gestaltung und der Tatsache, dass Sexualität zum Leben gehört“ – „Heterosexuelle, Lesben, Schwule, trans- und intergeschlechtliche Menschen – alle gehören gleichwertig zu unserer Kirche. Es darf hier keine Verurteilungen und Diskriminierungen mehr geben“. Doch obwohl diese Forderungen unter dem Appell „Verspielen Sie die letzte Chance nicht!“ gestellt wurden, wird bislang selbst das Problem der zahlreichen sexuellen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die seit 2010 an die Öffentlichkeit geraten (sind), unzureichend von der Bischofskonferenz thematisiert und aufgearbeitet. So wird unter anderem dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki „fehlende Transparenz“ vorgeworfen, weil er ein unabhängiges Gutachten zum sexuellen Missbrauch durch Priester wegen angeblicher methodischer Fehler nur eingeschränkt veröffentliche – eine Entscheidung, von der der Betroffenenbeirat ausgeschlossen wurde, wie Patrick Bauer, ein Betroffener, dem Deutschlandfunk sagte: „Man hat uns in dieser Sitzung das Gefühl gegeben: Lieber Betroffenenbeirat – Ihr müsst mit uns diese Entscheidung tragen. Wir hören auf Euch und das ist das Entscheidende: Wir hören auf euch. Das, was ihr uns sagt, machen wir. Das ist das, was uns vermittelt worden ist. Fakt war aber, dass da die Entscheidung längst gefallen war“, sagt Patrick Bauer. Entscheidungen in der katholischen Kirche scheinen also nach wie vor hinter verschlossenen Türen von Männern getroffen zu werden, während kaum Offenheit für jegliche Forderungen zur Aufarbeitung oder Reform gezeigt wird – nicht einmal, wenn sie aus den Reihen der immer weniger werdenden Mitglieder kommen, und nicht einmal, wenn sie von denen kommen, die Opfer des „lebensfremden“ Umgangs der katholischen Kirche mit Sexualität geworden sind. Die Frage danach, ob die katholische Kirche sich zu einem Ort der echten (sexuellen und geschlechtlichen) Vielfalt öffnen und reformieren kann besteht also: Nach dem Thesenanschlag „1.0“ vor über 500 Jahren, als Martin Luther 95, damals als radikal geltende, Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben soll, war das endgültige Ergebnis nicht etwa eine grundlegende Reform der katholischen Kirche – sondern die Bildung einer neuen. Angesichts steigender Austrittszahlen ist die Frage ist also nicht, ob es eine Veränderung geben wird – sondern ob diese inner- oder außerhalb der katholischen Kirche stattfinden wird.
#ZeigFarbe für LSBTI* im Norden
23. März 2021Weiterlesen Darüber hinaus soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie sich die aktuellen Beschränkungen auf das Leben von LSBTI* auswirken. „Die Corona-Pandemie verstärkt die Verletzlichkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) besonders. Die Gefahr von Gewalt und Anfeindungen, der LSBTI* in familiären Bereichen oder in Geflüchtetenunterkünften ausgesetzt sind, wächst dramatisch an. Zusätzlich finden Beratungs- und Unterstützungsangebote derzeit durch die Beschränkungen nicht statt - Rückzugsräume und Selbsthilfegruppen fehlen. Auf diese prekäre Situation möchten wir mit der Kampagne #ZeigFarbe aufmerksam machen und zu Solidarität aufrufen. Alle Menschen können sich an der Aktion beteiligen. Wer ein Plakat sieht, kann sich davor fotografieren und das Foto mit dem Hashtag #ZeigFarbe in den sozialen Medien teilen. Gemeinsam wollen wir so im ganzen Norden ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen“, so Andreas Witolla aus dem Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) Schleswig-Holstein. Neben der Kampagne initiierte der LSVD auch das Bündnis für Akzeptanz und Respekt mit über 40 engagierten Organisationen und Vereinen. Mit der Unterzeichnung der Lübecker Erklärung treten sie für die Bekämpfung von Diskriminierung und für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in Schleswig-Holstein ein. „In kleineren Städten und ländlichen Gemeinden steckt das Thema Akzeptanz von LSBTI* noch in den Kinderschuhen. Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans*- und intergeschlechtliche Menschen sind jedoch auch hier Teil der Gesellschaft und brauchen Räume zum Austausch und Unterstützungsangebote. Um das zu ermöglichen stehen wir mit Vertreter*innen vieler Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein im Austausch. Auch im Bündnis sind Städte und Kreise, aber auch Vereine, Verbände und Unternehmen organisiert und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Gemeinsam treten wir für ein buntes und vielfältiges Schleswig-Holstein ein“, so Andreas Witolla weiter. Die Kampagne wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des Aktionsplans Echte Vielfalt. Pressekontakt LSVD Schleswig-Holstein
Andreas Witolla
T. 0163 7675747
andreas.witolla@lsvd.de
Die Situation von LGBT in Russland
22. März 2021Weiterlesen In der damaligen Sowjetunion gab es zunächst keine LGBT-Bewegung und war Homosexualität verboten. Im Zuge der Systemtransformation wurde 1993 Homosexualität entkriminalisiert und führte zu einem Entstehen der LGBT-Bewegung. In den letzten Zwanzig Jahren kam es dann in Russland zu einem Erstarken der Bewegung und der Gründung neuer LGBT-Organisationen. In einigen Bereichen wuchs die Akzeptanz gegenüber LGBT, zum Beispiel in Teilen der Medienlandschaft und in der Popkultur. Trotzdem waren und sind die Einstellungen gegen LGBT-Personen in der Bevölkerung weiterhin negativ. Pride-Paraden oder Protestveranstaltungen riefen immer wieder starke homophobe Reaktionen hervor. Konservative Politik und Kirche fordern seit einigen Jahren die Bewahrung „traditioneller Werte“. Die kulturellen Werte der Nation seien bedroht und müssten vor Einfluss des Westens geschützt werden. Die Zunehmende Ablehnung gegenüber LGBT führte schließlich 2013 zur Verabschiedung eines Gesetzes gegen „homosexuelle Propaganda“. LGBT-Veranstaltungen und -Projekte werden seitdem unter dem Vorwand des Kinderschutzes verboten. Auch hatte das Gesetz eine Selbstzensur von Medien und weiteren Akteur*innen zur Folge, die ihre Berichterstattung oder Thematisierung von LGBT-Themen einschränkten. Eine weitere dramatische Konsequenz ist die Zunahme von Diskriminierung und Hassverbrechen gegenüber LGBT. In diesem Zusammenhang dient das Gesetz den homophoben Täter*innen unter anderem als Rechtfertigung. Die Opfer solcher Taten gehen aus Angst für weiterer Erniedrigung oder Gewalt oft nicht zur Polizei. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bestätigt in einem Bericht, dass das Gesetz die bestehende Feinseligkeit gegenüber LGBT verstärke und den Zugang zu Aufklärungs- und Hilfeangeboten, insbesondere für Jugendliche, blockiere. Die russische Regierung verabschiedete außerdem weitere Gesetze, die insgesamt oppositionelle Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen in ihren Rechten einschränken und ihre Arbeit erschwerten. Auch die Verschärfung des Versammlungsrechtes gehört dazu. Beispielhaft für die politische Verfolgung von LGBT-Aktivist*innen steht die Aktivistin Julia Tsvetkova. Die lesbische Feministin, Künstlerin und LGBT-Aktivistin ist wegen der Veröffentlichung von Zeichnungen mit feministischen und LGBT-Motiven Repressionen ausgesetzt, stand deswegen bereits unter Hausarrest und wurde zu Geldstrafen verurteilt. Wegen einer feministischen Zeichnung mit nackten Frauen wird sie nun beschuldigt, illegal Pornographie verbreitet zu haben. Ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International stufen sie als politisch Verfolgte ein. In einem Interview mit der Zeitschrift Siegessäule sagte Julia zu ihrem Fall: „Für viele Menschen im Westen ist es schwer vorstellbar, dass man im 21. Jahrhundert angeklagt werden kann, weil man sagt, dass Frauenkörper schön und stark sind und den Frauen selbst gehören. Wenn ich verurteilt werden sollte, werde ich definitiv nicht aufgeben und meinen Fall zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen.“ Es ist nicht überraschend, dass eine zunehmende Zahl an LGBT-Personen auf Grund der beschriebenen Entwicklungen ins Ausland und auch nach Deutschland migriert. Der Verein Quarteera, ein Zusammenschluss russischsprachiger queerer Menschen in Deutschland, setzt sich unter anderem für sie ein. Außerdem engagiert sich die Initiative gegen Homophobie in der russischen Community in Deutschland.
Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
20. März 2021Weiterlesen Diese kann sich auch in Gewalthandlungen ausdrücken. Weitere Formen sind Sexismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ein zentrales Element rechtsextremer Einstellungen. Der Soziologie und Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer, der zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit forscht, definiert diese folgendermaßen: „Werden Personen aufgrund ihrer gewählten oder zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit als ungleichwertig markiert und feindseligen Mentalitäten der Abwertung und Ausgrenzung ausgesetzt, dann sprechen wir von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.“ Nicht nur Personen fremder Herkunft, so Heitmeyer, können im Rahmen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Feindseligkeiten erfahren, sondern diese kann sich auch auf Personen beziehen, deren Lebensweise als von der Normalität abweichend interpretiert wird. Zentral ist dabei die Idee der Ungleichwertigkeit von Menschengruppen. Dabei stehen oftmals Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ausprägungen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Feindselige Einstellungen liegen oft nicht nur gegen eine Gruppe, sondern gegen mehrere Gruppen vor. Heitmeyer bezeichnet dies als „Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. Zur Erklärung, warum es zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kommt, werden in den Sozialwissenschaften verschiedene Theorien angewendet. So wird untersucht, inwieweit die Entstehung menschenfeindlicher Einstellungen mit Bildung, Beziehungen in der Familie oder Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt und welche ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren sich darauf auswirken. Durch diese Zusammenhänge wird auch klar, dass Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit veränderbar ist, da soziale Bedingungen zu ihrem Entstehen beitragen: „Das Ausmaß von Vorurteilen, Abwertungen, Diskriminierungen und Gewalt ist keine Naturkonstante, sondern abhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen“ so Heitmeyer.
Über Jahrzehnte nahmen Gerichte lesbischen Müttern im Falle von Scheidungen ihre Kinder
19. März 2021Weiterlesen Gerichte der Bundesrepublik entzogen Müttern bis mindestens in die 1980er Jahre ihre Kinder – wenn bekannt wurde, dass die Mütter lesbisch lebten. Dies führte auch dazu, dass Frauen die Existenz einer Partnerin verbargen. Die erste historische Studie zu dem Thema hat nun erstmals einen Teil dieser Unrechtsgeschichte aufgearbeitet. In Auftrag gegeben wurde sie vom Land Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel stellte die Untersuchung mit dem Titel „…in ständiger Angst…“ im Januar diesen Jahres vor und entschuldigte sich für das entstandene Unrecht: „Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Frauen, die sich scheiden ließen, um in einer Liebesbeziehung mit einer Frau zu leben jahrzehntelang das Sorgerecht entzogen wurde. Die Studie deckt strukturelle Diskriminierungen lesbischer Mütter bis zum Jahr 2000 auf. Das ist bedrückend und beschämend zugleich“ so Spiegel. Die Studie, legt auch Gründe dar, die zu der Diskriminierung lesbischer Mütter führten. Dazu gehören, dass die gesellschaftlichen Erwartungen in den 50er, 60er und 70er Jahren an Frauen waren, sich als Ehefrau und Mutter ausschließlich der Familie zu widmen. Auch das bis 1977 gültige Schuldprinzip im Scheidungsrecht führte dazu, dass schuldig geschiedene Ehepartner*innen den Unterhalt verloren. Außerdem galt damaligen Wertvorstellungen gemäß eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft für das Kindeswohl als bedenklich. Verantwortlich für die Forschungsarbeit war die Historikerin Dr. Kirsten Plötz, welche die Studie für das Institut für Zeitgeschichte und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld durchführte. Sie befragte für die Studie auch betroffene Zeitzeug*innen, die sich bereit erklärt hatten in Interviews über ihre schmerzhaften Erfahrungen zu berichten. Im einem Interview mit dem Deutschlandfunk erläutert sie die Schwierigkeiten im Forschungsprozess, da kaum offizielle Quellen vorhanden sind. „Wir haben ein unglaubliches Quellenproblem“, so Plötz dazu. Sie betont auch, wie erst 1984 erstmals gerichtlich entschieden wurde, dass die Bindung und die Versorgung des Kindes wichtig seien und das Kind bei einer offen lesbisch lebenden Mutter belassen werden konnte. „Es gab eine Veränderung, aber sehr langsam“, kommentiert Plötz.