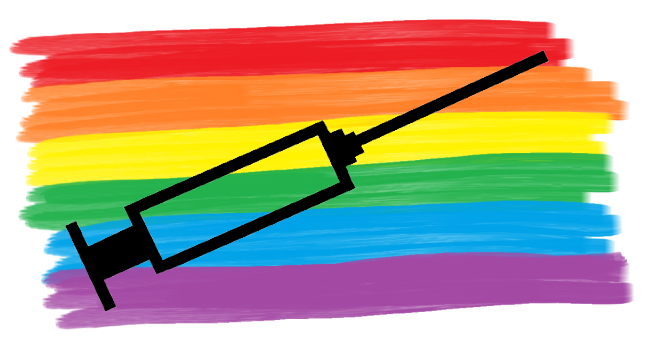Elternschaft in der EU: Eine Frage der Selbstverständlichkeit?
19. Dezember 2022Weiterlesen „Einer der wichtigsten Aspekte des Vorschlags besteht darin, dass die in einem EU-Mitgliedstaat begründete Elternschaft ohne spezielles Verfahren in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden sollte,“ so die Kommission. Bis jetzt sieht das Unionsrecht nach Auslegung des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) vor, dass EU-Staaten aufgrund des Rechtes zur Freizügigkeit eine Elternschaft aus einem anderen Mitgliedsstaat anzuerkennen haben – allerdings ist eine gleichgeschlechtliche Partner*innenschaft nicht überall anerkannt was für Familien zu Problemen führen kann. Im entsprechenden Fall hatte ein in Spanien lebendes lesbisches Ehepaar mit britischer und bulgarischer Staatsangehörigkeit geklagt. Bei der Geburt ihrer Tochter hatte die spanische Behörde eine Geburtsurkunde mit doppelter Mutterschaft ausgestellt. Nach einer Zusammenfassung der Tagesschau weigerte sich daraufhin die Stadt Sofia (Bulgarien), dem Mädchen einen Reisepass auszustellen. Zur Begründung hieß es: Die „öffentliche Ordnung“ lasse ausschließlich Geburtsurkunden von Mutter und Vater zu. Zudem sei nicht erkennbar, welches die leibliche Mutter sei. Laut EUGH sei dies jedoch nicht relevant. Spanien habe bestätigt, dass es sich bei beiden Frauen um die Mütter handele. Dies müsse auch Bulgarien anerkennen. Unabhängig von der leiblichen Elternschaft ergebe sich bereits aus der rechtlichen Elternschaft ein Anspruch auf die entsprechende Staatsangehörigkeit. Bulgarien sei zur Ausstellung eines Reisepasses verpflichtet. Wie die Kommission in ihrer Pressemitteilung jedoch einschränkend anmerkt, gelte dieses Urteil nicht für die Ansprüche, die sich aus einer Elternschaft im nationalen Recht ergeben. Diese würden weiterhin beim jeweiligen Staat verbleiben und müssten in jedem Fall einzeln und zumeist mit hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand eingeklagt werden. Damit findet zusätzlich eine Diskriminierung statt. Der neue Vorschlag soll diese Lücke füllen, indem er Rechtssicherheit für Familien und Entlastung bei den Prozesskosten sowohl für die Familien selbst als auch für die Verwaltungs- und Justizsysteme der Mitgliedstaaten vorsieht. So positiv dieser neue Vorschlag auch klingt, so harsch ist die an ihm geübte Kritik. Nach einer Stellungnahme der europäischen LGBTI*-Bürgerrechtsorganisation Forbidden Colours ändere dieser Vorschlag nichts an dem eigentlichen Problem, dass der Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und/oder sexueller Ausrichtung weiterhin bei den Mitgliedstaaten verbleibe. Es fehle nicht am Recht, so die NGO, sondern an dessen Umsetzung. „Mitgliedstaaten wie Bulgarien und Rumänien ignorieren Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs zur gegenseitigen Anerkennung der Elternschaft. Die Europäische Kommission ist nicht bereit, diese Urteile gegenüber ihren Mitgliedstaaten durchzusetzen. Das nennen wir in der Rechtswissenschaft: Pflichtvergessenheit“, so der konkrete Vorwurf von Forbidden Colours. Wie das Magazin schwullissimo in Bezug auf die Stellungnahme von Forbidden Colours ergänzt, seien seit 14 Jahren bereits vier Kommissare an einer wirkmächtigen Rechtsumsetzung gescheiter. Einmal mehr wird damit deutlich, dass Rechte immer Teil ihrer jeweiligen Gesellschaft und ihrer Akteure bleiben, die damit die mühevolle, aber notwendige Aufgabe haben, diese für sich selbst, aber auch für Dritte zu hinterfragen und ständig aufs Neue einzufordern.