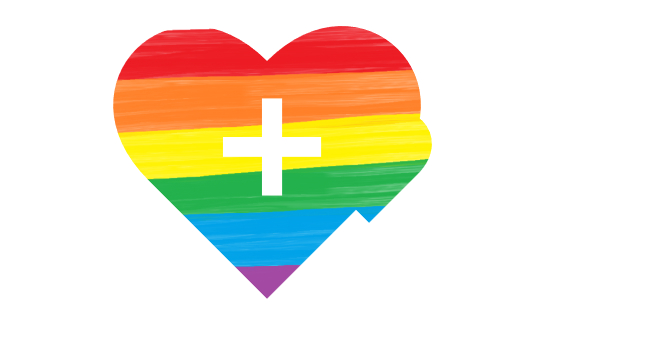Der italienische Senat hat ein Gesetz zum Verbot von Straßenwerbung, die als sexistisch oder diskriminierend angesehen werden kann, verabschiedet. Das Gesetz, das Teil eines Verkehrs- und Infrastrukturdekrets ist, verbietet auf der Straße und in allen Verkehrsmitteln Werbung, die Frauen erniedrigt und Geschlechterstereotypen aufrechterhält, sowie solche, die als schädlich für bürgerliche und politische Rechte angesehen wird oder diskriminierende Botschaften gegen Homosexuelle, ethnische und religiöse Gruppen oder Menschen mit Behinderungen enthält.
Weiterlesen
Diese Nachricht kommt, nachdem das italienische Parlament Anfang des Monats ein umfassendes Anti-Homofeindlichkeits-Gesetz abgelehnt hat, welches Homofeindlichkeit zu einem Verbrechen gemacht hätte, das ähnlich wie Rassismus behandelt wird und Gefängnisstrafen für Straftäter*innen vorsieht. Es sollte so diskriminierende Handlungen und die Aufstachelung zur Gewalt gegen Schwule, Lesben, trans* Personen und Menschen mit Behinderungen unter Strafe stellen.
Nun sind Politiker*innen der extremen Rechten erzürnt, dass das Gesetz gegen diskriminierende Werbung erlassen worden ist. Andrea Bertoli, ein Senator der rechtsextremen Brüder Italiens, sagte, dass das zuvor gescheiterte „beschämende“ Anti-Homofeindlichkeits-Gesetz nun „in einem Verkehrsdekret wiedergegeben“ worden sei. Lucio Malan, ein weiterer Senator der Brüder Italiens, bezeichnete das Gesetzeselement, welches verbietet Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität zu diskriminieren, als „ideologische Norm zur Einschränkung der Meinungsfreiheit“.
Die Maßnahme löste auch einen Chor von Beschwerden von Abtreibungsgegnern aus, da es sie daran hindert, die Straßen mit Plakaten zu pflastern, die für Frauen, die abgetrieben haben, beleidigend sind. Die Vereinigung ProVita führt regelmäßig aggressive Anti-Abtreibungskampagnen im ganzen Land durch, bei denen riesige Plakate an den Wänden angebracht werden, auf denen Föten im Mutterleib abgebildet sind oder welche die Einnahme der Abtreibungspille mit dem Konsum von Gift gleichsetzen.
„Das Gesetz bezieht sich nicht speziell auf die Abtreibung, aber es weitet die Maßnahme auf sehr intelligente Weise aus, was bedeutet, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese Art von Werbung zu unterbinden“, sagte Luisa Rizzitelli, eine Frauenrechtsaktivistin. Abtreibung ist in Italien seit 1978 legal, und das Gesetz wird Werbung verbieten, die dieses Recht verletzt und Frauen angreift, weil sie abgetrieben haben, fügte Rizzitelli hinzu. Rizzitelli sagte, die Maßnahme sei „ein großer Schritt nach vorn“, um sexistische Werbung zu verbieten, die überall in Italien zu finden sei. Die großen Marken seien viel aufmerksamer geworden, aber in kleineren Städten finde sich immer noch Werbung, die die Würde von Frauen verletze, fügte sie hinzu. „Alle Frauenverbände versuchen seit Jahren, dies zu stoppen“, so Rizzitelli. „Dieses Gesetz könnte dazu beitragen, auch einen kulturellen Wandel herbeizuführen“.
Schließen