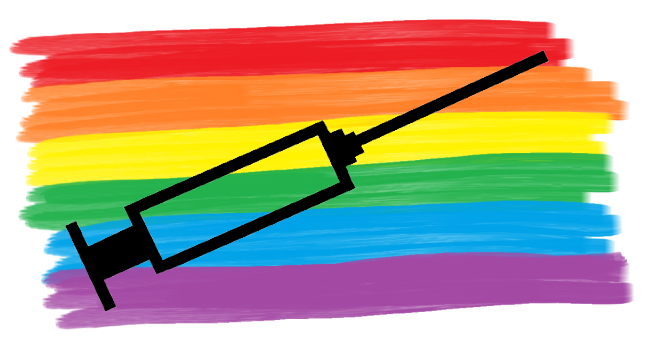Weiterlesen Denn wer sich – wie beispielsweise die Grünenpolitikerin Tessa Ganserer – nicht einem Verfahren nach dem „Transsexuellengesetz“ oder Personenstandsgesetz unterzogen hat (wegen der diskriminierenden Bedingungen), muss beim Vorzeigen von Impfnachweisen immer auch den Deadname offenbaren. Dies kann sich für trans Personen durchaus unangenehm, verunsichernd, und demütigend anfühlen – selbst, wenn die Impfpass-kontrollierende Person einen guten Umgang damit findet. Nachdem vier Bundesländer (Ba-Wü, NRW, Brandenburg, Hessen) eindeutige Hinweise auf den Ergänzungsausweis und die Lage von trans- und intergeschlechtlichen Personen in ihre Corona-Verordnungen beziehungsweise in den Erläuterungen aufnahmen, gibt es hier nun in die offizielle Möglichkeit, Nachweise auch auf den richtigen Namen ausstellen zu lassen, indem man einen Ergänzungsausweis der dgti nutzt. Damit lassen sich Impfungen und digitale Test- und Genesenennachweise, etwa über die Corona-Warn-App, mit dem richtigen Namen auf dem Display nachweisen (queer.de berichtete). Inoffiziell möglich ist dies auch in Berlin möglich (laut der prinzipiellen Rechtsauffassung des Berliner Senats), und auch Rheinland-Pfalz hat der Möglichkeit, den Ergänzungsausweis als Identitätsnachweis bei den Corona-Dokumenten zu verwenden, gegenüber der dgti zugesagt. Öffentlich bekannt gemacht wurde darüber allerdings noch nichts, und da Kontrollen der entsprechenden Nachweise in den meisten Fällen durch etwa Türsteher*innen oder Kellner*innen erfolgen, nützt dies im Zweifelsfall wenig. Eine Öffentlich-Machung, etwa in der eigenen Corona-Schutzverordnung, sei daher laut Petra Weitzel, Vorsitzende des dgti, entscheidend, denn nur so könnten sich die Nutzer*innen darauf berufen. Weitzel rät darum, den Link zu den bestehenden Verordnungen auf dem Smartphone abzuspeichern und aufzurufen, falls es Diskussionen gibt. Dies sei nötig, denn der Nachweis könnte von Menschen kontrolliert werden, die gar nicht wissen, was ein Ergänzungsausweis ist. Doch auch der Ergänzungsausweis ist offiziell nur in Verbindung mit dem amtlichen Personalausweis gültig, so dass Kontrolleur*innen die Vorlage des zugehörigen Personalausweises verlangen können, und damit Einsicht in den Deadname und vielleicht sogar ein altes Passfoto erhalten, wodurch sie als trans, inter oder nicht-binär zwangsgeoutet werden. Auch auf entsprechende Kommentare, intime Nachfragen oder Anfeindungen müssten auch sie sich dann also weiterhin einstellen.
Lebensbereiche
Polen verabschiedet „LGBT+-Propaganda“-Verbot
28. Februar 2022Weiterlesen Dieser Schritt kam, nachdem das Parlament einen Gesetzentwurf bereits im November 2021 debattierte, und nach jahrelangem Bestehen sogenannter „LGBT-freier Zonen“, die von der EU als queer-feindlich kritisiert wurden. Nun seien die PiS-Abgeordneten laut berichten „in tosenden Beifall“ ausgebrochen, als das Gesetz verabschiedet wurde - es wird nun an den Präsidenten Andrzej Duda zur Unterzeichnung weitergeleitet. Aktivist*innen jedoch erklärten gegenüber PinkNews, dass die Gesetzgebung eine Kultur der "Kontrolle und Angst" in den Schulen einführen werde, wodurch Ungleichheit und Ausgrenzung zunehmen würden. So würden mit dem Gesetzentwurf von der Regierung zugelassene „Einpeitscher“ eingeführt, die die Schulen unter Kontrolle halten sollen. Sie würden die Macht haben, Schulleitungen einzustellen und zu entlassen und externe Gruppen daran zu hindern, in den Schulen zu arbeiten. Zudem müssten Pädagog*innen ihre Unterrichtspläne spätestens zwei Monate vor Unterrichtsbeginn von den Aufsichtsbehörden genehmigen lassen – werde dabei festgestellt, dass die Lehrpläne nicht mit den strengen Werten der Regierung übereinstimmen, können die Regierungsmandatierten Schulleitungen fristlos und ohne Einspruchsmöglichkeit entlassen. Außerschulische Aktivitäten, die von Nichtregierungsgruppen durchgeführt werden, müssten demnächst erst von den Minister*innen genehmigt werden, was ihnen mehr Kontrolle über das Schulleben gäbe. Lehrkraftgewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen warnten, dass die Gesetzgebung einer Zensur gleichkomme und der Regierung ermögliche, den Unterricht über LGBT+ und reproduktive Rechte zu unterbinden. Das Gesetz sei „eine Katastrophe für die Schulen in Polen“, sagte Justyna Nakielska, Beauftragte für LGBT+-Rechte bei Kampania Przeciw Homofobii. Junge Menschen würden für Toleranz, Offenheit für Vielfalt, kritisches Denken und Unabhängigkeit bestraft. Das Gesetz führe eine Atmosphäre der Denunziation, Kontrolle und Angst in den Schulen ein. "LGBT-Jugendliche werden sich in den Schulen immer weniger sicher fühlen", sagte sie und zitierte einen Bericht der EU-Grundrechteagentur aus dem Jahr 2020, wonach vier von zehn queeren Jugendlichen in Polen ihre Identität in der Schule verbergen. "Ungleichheit und Ausgrenzung", so Nakielska, "werden zunehmen und es wird immer weniger Platz für LGBT-Jugendliche geben."
Was ist Deadnaming und wie können wir es vermeiden?
23. Februar 2022Weiterlesen Ein "Deadname" ist der Name einer trans Person vor ihrer Transition. Die Definition von Deadnaming lautet also, dass eine trans Person mit ihrem früheren Namen statt mit ihrem neuen Namen angesprochen wird. Dies gilt als Deadnaming, unabhängig davon, ob es absichtlich geschieht oder nicht. Während manche Menschen schlichtweg transfeindliche Meinungen haben, vergessen viele die Namensanpassung oder deren Bedeutung ohne bösen Willen, und sprechen trans Personen mit dem Deadname an (zum Beispiel: Peter sagt zu der trans Frau Anna, Deadname Tim: „Tim, kann ich das Wasser haben?“, statt „Anna, kann ich das Wasser haben?“). Es kommt auch häufig vor, dass trans Personen ge-misgendered werden, d.h. dass die falschen Geschlechtspersonen, mit denen sie sich nicht identifizieren, genutzt werden (zum Beispiel: Peter sagt über die trans Frau Anna: „Er ist gleich da“, statt „Sie ist gleich da“). Ständig werden trans Personen im Laufe ihres Lebens damit konfrontiert, sei es in der Familie, in persönlichen Beziehungen, in der Ausbildung oder im Arbeitsumfeld. Der häufigste Ort, an dem Deadnaming vorkommt, ist in staatlichen Einrichtungen oder bei Kontrollen, in denen Beamt*innen gesetzlichen Namen verwenden dürfen. Zudem ist es in vielen Ländern, unter anderem auch Deutschland, mit extrem viel Aufwand und Kosten verbunden, den Namen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Sowohl Deadnaming als auch Misgendering können für die Psyche von trans Personen durchaus schädlich sein, da sie sich in ihrer wahren Identität als entwertet und nicht respektiert fühlen können. Denn im Wesentlichen demonstriert Deadnaming, dass sie in ihrer wahren Geschlechtsidentität nicht unterstützt und wahrgenommen werden, sei es vor, während oder nach der Transition. Solche Diskriminierungen kommen häufig vor (nicht zuletzt im Deutschen Bundestag), wobei sich Menschen der Schwere ihrer Angriffe auf Identität entweder nicht bewusst sind, oder diese Angriffsfläche bewusst instrumentalisieren (wie nicht zuletzt durch Alice Schwarzer). Für Menschen, denen es jedoch tatsächlich nicht bewusst ist: Die Selbstmordrate von trans Personen ist viel höher als die der Allgemeinbevölkerung. So ergab eine Studie, dass trans-männliche Jugendliche mit 50,8 Prozent die höchste Rate an Selbstmordversuchen aufweisen. Dies zeigt erschütternd, wie wichtig Empathie in solchen Situationen ist – vielleicht reicht aber auch schon der Gedanke, selbst bei einem Namen genannt zu werden, mit dem man sich nicht identifiziert – obwohl man sich unter einem anderen vorgestellt hat. Natürlich kann es aus Versehen trotzdem geschehen – wie bei einem Freund, der sich vor kurzem als trans Mann geoutet hat, und noch immer Gewohnheit ist, ihn bei seinem alten Namen zu nennen. Wie also kann man "Deadnaming" vermeiden?
Transfeindlichkeit im Deutschen Bundestag
23. Februar 2022Weiterlesen Indem sie dies aberkennt, hat Beatrix von Storch jedoch am Donnerstag in einer Bundestagsrede die trans Abgeordnete Tessa Ganserer persönlich attackiert, wobei sie ihre Parlamentskollegin in einer Debatte zum Internationalen Frauentag als Mann bezeichnete (Misgendering) und sie bei ihrem abgelegten Deadnamen bezeichnete. So polemisierte sie gegen Trans-Rechte, warf dem Bundestag vor, der vermeintlichen „Gender-Ideologie“ anzuhängen, und zitierte die transfeindliche Autorin Alice Schwarzer, die erst kürzlich (wieder) in der Zeitschrift „Emma“ Stimmung gegen trans Frauen, insbesondere Tessa Ganserer, gemacht hatte. Dabei rechtfertigte von Storch ihre Hasstirade damit, dass es „schlicht rechtswidrig sei“, dass Ganserer über die Frauenquote der Grünen in den Bundestag eingezogen war, weil diese sich noch keiner geschlechtsangleichende Operation unterzogen und ihr rechtliches Geschlecht noch nicht an ihre Identität angepasst hat (wohlgemerkt aus Protest gegen das diskriminierende „Transsexuellengesetz“). Doch von Storch fantasierte: „Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin.“ Damit offenbart sich, dass die AfD-Parteichefin nicht nur verfehlt hat, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich ein Mensch aus strategischen Gründen menschenverachtender und hasserfüllter Attacken wie von Storchs aussetzen würde, sondern auch missverstanden hat, was es bedeutet, trans zu sein. Es geht dabei nämlich nicht nur um eine Namensänderung, sondern die Identität der Person – die valide ist, ob es Beatrix von Storch und Alice Schwarzer nun gefällt oder nicht. Dies betonten auch Parlamentskolleg*innen, wie Ganserers Parteifreundin Britta Haßelmann: „Ich wende mich an Sie alle: Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin.“ Sie sei Teil der Frauen, die 59 Prozent der grünen Bundestagsabgeordneten stellten. „Niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder darüber zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt.“ Tessa Ganserer saß bei der Hassrede von Storchs im Plenum. Die bayerische Abgeordnete hielt später ihre erste Bundestagsrede in einer Debatte zur Einsetzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung – fachlich und ohne auf die Angriffe gegen ihre Person einzugehen. Wie sie das alles fand, behielt sie zunächst für sich. Sie wolle nicht zulassen, dass ihre "grundgesetzlich geschützten Menschenrechte Gegenstand einer öffentlichen Debatte" werden, teilte sie der Süddeutschen schriftlich mit. Auf Twitter zeigten sich Politiker*innen der demokratischen Fraktionen nach der Debatte erschüttert. Die SPD-Politikerin Josephine Ortleb schrieb: "Wer eine Kollegin angreift, greift uns alle an. Menschenverachtende Reden bleiben nicht unwidersprochen." Auch Jürgen Lenders, der LSBTI-Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, stellte sich in einer Stellungnahme hinter Ganserer: "Frau von Storch hat von sexueller Identität und geschlechtlicher Vielfalt keine Ahnung", so Lenders. Diskriminierungen dieser Art hätten im Bundestag nichts zu suchen. Und "Trans Frauen sind Frauen und [Tessa Ganserer] ist eine Frau!", erklärte Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung. „Was Frau von Storch heute im Bundestag von sich gegeben hat, ist menschenfeindliche Hetze.“, benannte er von Storchs Rede treffend. „Aber das wird die Ampelkoalition garantiert nicht daran hindern, das Transsexuellengesetz abzuschaffen.“
Thailand: Jetzt doch Ehe für Alle?
21. Februar 2022Weiterlesen Das Bezirksamt Bang Khunthian gab queeren Paaren die Möglichkeit, ihre Ehe zu registrieren, indem ihnen das Büro Urkunden zur Anerkennung ihrer Beziehung ausstellt, ähnlich wie Heiratsurkunden – jedoch rechtlich nicht bindend. Dieser Schritt kam, nachdem das thailändische Verfassungsgericht im November 2021 einen Antrag auf die Gleichstellung der Ehe abgelehnt hatte. Somit setzte sich das BMA mit der Valentinstag-Aktion für die Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Gruppen ein. Man hoffe, in Zukunft Gleichstellungsgesetze wie in anderen Ländern zu haben, so der Bezirksleiter von Bang Khunthian. Ein weitere BMA-Sprecher sagte, die Aktion sei Teil eines Vorstoßes zur Verabschiedung des vorgeschlagenen Gesetzes über die zivile Partner*innenschaft, so dass Liebende aller Geschlechter ihre Ehe legal und rechtsbindend registrieren lassen könnten. Nachdem das Repräsentant*innenhaus nun mit einer Zweidrittelmehrheit für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt hat, ist die Chance groß, dass das Gesetz bis Ende 2022 liberalisiert wird. Dies berichtet die Thailand Gay and Sexual Diversity Alliance, die mit der Move Forward Party im thailändischen Parlament zusammengearbeitet hat. Doch obwohl das Parlament in dieser Woche eine Änderung des Gesetzes befürwortete, stimmten die Abgeordneten nicht förmlich über die erste Lesung ab, sondern leiteten die Unterlagen an das Kabinett weiter, das sie innerhalb von 60 Tagen prüfen muss. Es ist jedoch bekannt, dass es dort Unterstützung für die politischen Rechte von Homosexuellen gibt, da das Kabinett das allgemeine Prinzip im Juli 2020 gebilligt hat. Nun stellt sich die Frage, ob das Kabinett die vollständige Gleichstellung mit der heterosexuellen Ehe akzeptiert oder die Vorschläge zugunsten der zivilen Lebensgemeinschaften abschwächt, die nicht genau dieselben Garantien bieten. Beispielsweise würden zivile Partnerschaften wahrscheinlich die Rentenansprüche homosexueller Partner*innen einschränken und Adoptionen problematischer machen. Thailändische Aktivist*innen jedoch hoffen darauf, dass es die Homo-Ehe bis Weihnachten 2022 geben wird.
Weiterlesen Dabei stammen einige Aufsätze von Verwandten oder Freund*innen und jeder vierte Beitrag wurde anonym veröffentlicht, denn es gibt enormen Druck auf queere Menschen, weil die katholische Kirche bislang jede sexuelle Orientierung, die von Heterosexualität abweicht, ablehnt. So können queere Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten - ob in Pfarreien, Kindergärten oder Altenheimen - jederzeit entlassen werden. Drei der anonymen Beiträge stammen aus dem kirchlichen Bereich. „Ich bin ein Priester. Und ich bin schwul“, heißt es in einem Beitrag, der den Schmerz darüber zum Ausdruck bringt, dass Homosexuelle, selbst wenn sie zölibatär leben, nach den vatikanischen Vorschriften überhaupt nicht Priester werden dürfen. Wolfgang Rothe, der das Buch herausgegeben hat, sagte gegenüber der DW, er wolle mit dem Manuskript die Realität queerer Menschen in der katholischen Kirche "so umfassend wie möglich" darstellen und damit "einen Perspektivwechsel in unserer Kirche herbeiführen". Rothe sagte, er selbst sei "in Tränen ausgebrochen", als er viele der Beiträge zum ersten Mal gelesen habe. Er hoffe, dass es den Leserinnen und Lesern ähnlich gehe und sie verstehen, wie sehr queere Menschen in der Kirche unter Diskriminierung und Ausgrenzung leiden. "Dieses Leiden muss ein Ende haben", sagte er. Das Buch wurde acht Tage nach dem Coming-out von 125 queeren Kirchenmitarbeitern veröffentlicht, das in Deutschland großes Aufsehen erregte. Das Timing war zufällig, aber es zeigt den wachsenden Ruf nach Reformen. Noch am vergangenen Sonntag hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, das Coming-out zahlreicher queerer Mitarbeiter seiner Kirche begrüßt. "Wir haben Menschen tief verletzt und tun das auch heute noch", sagte er in der ARD. So ist auch die Sammlung ein Katalog von Verletzungen, Ängsten und Frustrationen, aber auch von Hoffnungen, die an den Glauben geknüpft sind, und von schmerzhaften Erfahrungen mit der Idee von Heimat und Identität. Viele drängen mittlerweile auf die Anerkennung von queeren Menschen in der Kirche, auch Geistliche wie Bischof Heinrich Timmerevers und Cardinal Reinhard Marx. Der Ruf nach entschlossenem Handeln wird also immer lauter – es bleibt nun abzuwarten, ob ihn die katholische Kirche auch hören kann.
Russland scheitert an Versuch eine LGBTQ-Rechtsgruppe aufzulösen
16. Februar 2022Weiterlesen Ein Gericht in St. Petersburg wies am Dienstag eine vom russischen Justizministerium eingereichte Klage ab, in der das Russische LGBT-Netzwerk beschuldigt wird, „LGBT-Ansichten“ zu verbreiten und sich an Aktivitäten zu beteiligen, die „traditionellen Werten“ zuwiderlaufen würden. Daher erklärten russische Beamte, sie wollten die Sphere Foundation, die juristische Gruppe, die die LGBTQ-Organisation betreibt, „liquidieren“. Sowohl das Russische LGBT-Netzwerk als auch die Sphere Foundation sind in Russland bereits als ausländische Agenten ausgewiesen. Tanya Lokshina, stellvertretende Direktorin der Abteilung Europa und Zentralasien von Human Rights Watch, sagte die Entscheidung des Gerichts, nicht auf die Klage zu reagieren sei eine gute Nachricht für die unmittelbare Zukunft: „Ihr erster Schritt ist gescheitert, aber ich glaube nicht, dass sie aufgeben werden, denn das, was passiert ist, steht im Einklang mit dem anhaltenden, sehr beunruhigenden Trend, unabhängige Stimmen in Russland zu unterdrücken.“ Dabei seien Journalist*innen und LGBTQ-Aktivist*innen häufig Zielscheibe dieser staatlichen Bemühungen. Die russische Regierung sei nur bereit, Homosexuelle zu tolerieren, solange sie sich verborgen hielten. Denn auch wenn die Identifizierung als LGBTQ in Russland nicht mehr verboten ist, haben Gesetze wie das russische „Schwulenpropaganda“-Gesetz aus dem Jahr 2013 weiterhin Bestand. Dieses verbietet wie ähnliche spätere Gesetze in Ungarn und Polen die „Förderung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen bei Minderjährigen“. So argumentierte Lokshina, dass es sich bei der Klage „nicht um eine juristische Aktion“, sondern „um eine rein ideologische Aktion und einen unverhohlenen Akt homofeindlicher Zensur“ handele. Auch Igor Kochetkov, russischer LGBTQ-Aktivist und Gründer der Sphere Foundation, argumentierte, dass die Behauptungen in der Klage „eher ideologisch als rechtlich begründet“ seien: „Dies ist politische Verfolgung vom Feinsten. Und das Justizministerium versucht diesmal nicht einmal, dies zu verbergen“. Das in St. Petersburg ansässige Russische LGBT-Netzwerk ist dafür bekannt, dass es Aktionen gegen die Anti-LGBTQ-Politik und -Aktionen des Landes anführt, darunter die schwulenfeindliche Säuberung in Tschetschenien, die 2017 landesweit Schlagzeilen machte. Seitdem wurden laut Human Rights Watch mindestens 140 schwule und bisexuelle tschetschenische Männer in der halbautonomen russischen Region misshandelt und inhaftiert. Das russische LGBT-Netzwerk verteidigte seine Mission in einer Erklärung gegenüber NBC News: „Wir weigern uns, aufzugeben und uns von der Regierung abschalten zu lassen; wir weigern uns, zu akzeptieren, dass die Unterstützung von LGBT+-Personen nicht der Idee der "Wohltätigkeit" entspricht, wie es in ihrer Behauptung heißt. LGBT+-Menschen sind Bürger dieses Landes wie jede andere gesellschaftliche Gruppe und verdienen die gleichen Rechte und Freiheiten“.
Fachstelle für trans* Beratung und Bildung
15. Februar 2022Weiterlesen Wir unterstützen trans*Personen in ganz Schleswig-Holstein. Wir sind Ansprechstelle für alle Fragen zu trans*Geschlechtlichkeit und soziales Zentrum für die Community. Wir stehen für geschlechtliche Selbstbestimmung auf Basis der Menschenrechte. Als Beratungsstelle bieten wir professionalisierte Peerberatung von und für trans*Personen und An-/Zugehörige und begleitete Gruppen für Personen aus dem trans*Spektrum. Wir halten Bildungsangebote für alle interessierten Personenkreise bereit und machen Öffentlichkeitsarbeit in ganz Schleswig-Holstein. Wir fördern das Communitybuilding mit verschiedenen Angeboten für trans*Personen wie Freizeitgruppen, trans*Sport, Binder-Börse und Veranstaltungen. trans*support lebt von der Mitarbeit aus der Community – wir freuen uns immer über neue Menschen! Webseite: https://transsupport.de/ Kontakt: hallo@transsupport.de Beratungsteam: beratung@transsupport.de
Was die Bundespräsidentenwahl für queere Rechte bedeutet
14. Februar 2022Weiterlesen Zunächst offenbarte schon der Wahlprozes, dass vor dem Bundespräsidenten als repräsentativer Figur die Aufgabe liegt, für eine weniger menschenfeindliche Einstellung zu queeren Menschen in der Bundesversammlung zu sorgen. So tweetete die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum in Reaktion auf Aufstellung von Dragqueen Gloria Viagra und Rapperin Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray als Wahlleute: „Nichts könnte deutlicher den kulturellen #Verfall unserer #Nation sichtbar machen.“ Ferner erklärte die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst in einem Interview über Bitch Ray, dass „eine junge Dame – mehr oder weniger, so genau hab ich da nicht mehr geguckt nach dem ersten Anblick“ sie traumatisiert hätte, das habe ausgesehen „wie aus der Freakshow“. Und auch AfD-Parteivizechefin Beatrix von Storch, welche stets einen vermeintlichen „Gender-Wahn“ fürchtet, zeigte sich auf Twitter empört über „diese Clowns“. Außerdem teilte sie mit, dass sie Lady Bitch Ray „immerhin“ ihre „Nazis Raus – #NoAfD“-Tasche abnehmen ließ und fügte hinzu: „Da hat sie (er? es?) vielleicht rumgeheult.“ Vor dem Hintergrund solch hasserfüllter und Menschenwürde-verachtender Aussagen in der Bundesversammlung, scheint es also mehr als notwendig, dass Steinmeier als Bundespräsident Stimmung gegen Queerfeindlichkeit macht. Doch, obwohl er laut AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah als „Linksradikaler“ gilt, lässt sich abwarten, ob Steinmeiers Wahl eine gute Nachricht für queere Menschen ist, wie es ein Artikel auf Queer.de https://www.queer.de/detail.php?article_id=41174 bezeichnet. So bat er am 3. Juni 2018 als erster Bundespräsident queere Menschen um Vergebung für die staatliche Verfolgung in Deutschland, auch nach 1945: „Ihr Land hat Sie zu lange warten lassen. Wir sind spät dran. Was gegenüber anderen gesagt wurde, ist Ihnen bisher versagt geblieben. Deshalb bitte ich heute um Vergebung – für all das geschehene Leid und Unrecht, und für das lange Schweigen, das darauffolgte.“ Es folgten weitere öffentliche Statements für die Rechte queerer Menschen, wie die Bezeichnung homofeindlicher Herabsetzungen als „Anschlag auf unsere Demokratie“ und Meinungsfreiheit als „keine Legitimation“ für Queerfeindlichkeit. Zum 30. Jubiläum des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) bedankte er sich ausdrücklich für deren Engagement und sagte in einer Ansprache. „Ein Skandal liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität verächtlich gemacht oder benachteiligt werden. Was für eine zivilisatorische Wendung! Welch ein Fortschritt!“ Gerade beim zu erwartenden heftigen Widerstand gegen die queerpolitischen Reformen der Ampelkoalition, vor Allem aus den Reihen der Union und AfD, wird sich zeigen, ob Steinmeier diese „Wendung“ und diesen „Fortschritt“ auch weiterhin unterstützen wird, indem er die Rechte und Würde von queeren Menschen öffentlich verteidigt.
Weiterlesen Der Bericht von Human Rights Watch (HRW) verzeichnete seit August 2021 fast 60 Fälle von gezielter Gewalt gegen LGBTQ+-Personen, von denen viele beschrieben, wie die Taliban-Herrschaft ihr Leben zerstört habe. "Die Dinge waren immer hart", sagte Heather Barr, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Frauenrechte bei HRW. "Aber die Menschen hatten Wege gefunden, zu überleben, eine Gemeinschaft aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen, und sie hatten die Hoffnung, dass sich die Dinge allmählich verbessern würden. Am 15. August endete all das." Homosexualität war unter Ashraf Ghani, dem gestürzten Präsidenten Afghanistans, verboten und konnte mit Gefängnis bestraft werden. In dem HRW-Bericht heißt es jedoch, dass die Taliban "eine harte Linie gegen die Rechte von LGBT-Personen eingeschlagen haben" und sich auf die Scharia berufen. "Wir haben mit LGBT-Afghanen gesprochen, die Gruppenvergewaltigungen und Mob-Angriffe überlebt haben oder von ihren eigenen Familienmitgliedern, die sich den Taliban angeschlossen haben, gejagt wurden, und sie haben keine Hoffnung, dass staatliche Institutionen sie schützen werden", sagte J. Lester Feder, Senior Fellow für Notfallforschung bei OutRight Action International, der zu dem Bericht beigetragen hat. "Für die LGBT-Personen, die aus dem Land fliehen wollen, gibt es nur wenige gute Möglichkeiten; die meisten Nachbarländer Afghanistans kriminalisieren ebenfalls gleichgeschlechtliche Beziehungen. Man kann gar nicht genug betonen, wie verheerend - und erschreckend - die Rückkehr der Taliban-Herrschaft für LGBT-Afghan*innen ist." Ein 16-jähriges trans Mädchen beschrieb dem Guardian, wie sich ihr Leben in den letzten Monaten verschlechtert habe. "Ich trage gerne Make-up, ich mag Kleider und ich liebe es zu tanzen. Aber meine Familie hat das alles nicht erlaubt", sagte die Teenagerin dem Guardian. "Sie sperrten mich mit Ketten ein und schlugen mich. Sie rasierten mir den Kopf, zerrissen meine Kleidung und beschimpften mich als Ezaak [eine abfällige Bezeichnung für Homosexuelle]". So beschrieb sie die Schrecken des Aufwachsens als trans Person in einem zutiefst konservativen Land wie Afghanistan. Faraydoon Fakoori von Paiwand 34, einer Organisation, die sich für geschlechtsspezifische Minderheiten in Afghanistan einsetzt, sagte: "Afghanistan war schon immer eine konservative Gesellschaft, aber nach der Ankunft der Taliban hat sich die Situation noch verschlimmert. Wir sehen viele Fälle von Gewalt, Belästigung und sogar Vergewaltigung". Im Jahr 2021 sagte ein Taliban-Sprecher gegenüber der deutschen Bild-Zeitung: "Für Homosexuelle kann es nur zwei Strafen geben: entweder Steinigung, oder er muss sich hinter eine Mauer stellen, die auf ihn herunterfällt."